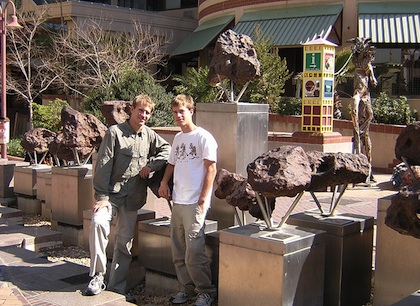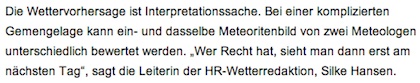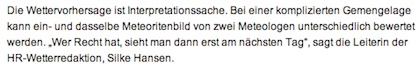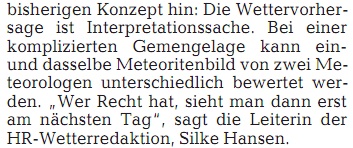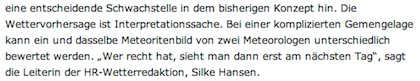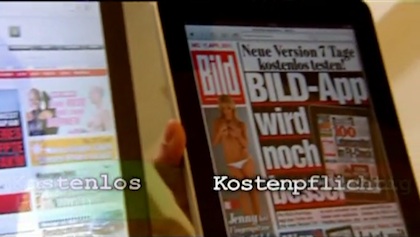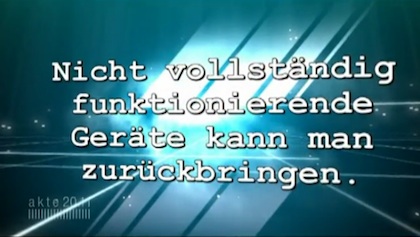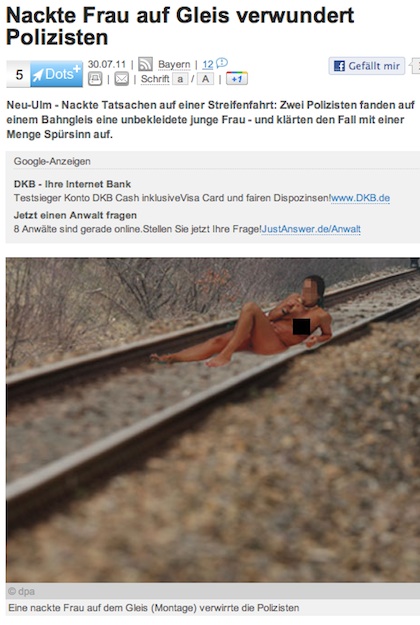Man kann nur hoffen, dass die Berichterstattung über die Apokalypse bei der ARD nicht in die Zuständigkeit des Hessischen Rundfunks fällt. Allein der Gedanke, dass Chefredakteur Alois Theisen es sich natürlich nicht nehmen lassen würde, die Welt persönlich armerudernd abzumoderieren, sich dabei vollständig auf die Kompetenz eines einzigen Reiter-Experten verlassen müsste, der dann aber aufgrund anderweitiger Verpflichtungen doch nicht ins Studio käme, so dass der entsprechende „Brennpunkt“ ohne jede Gewissheit endete, ob sich der Kauf eines Apfelbäumchens lohnt oder ein Paar Gummistiefel reicht…

Am Montag sind, wie erwartet, die Kurse an den Börsen eingebrochen. Die ARD nahm deshalb nach der „Tagesschau“ einen viertelstündigen „Brennpunkt“ mit dem Titel „Turbulenzen an den Finanzmärkten“ ins Programm, der damit endete, dass Alois Theisen noch einmal konkret zusammenfasste, welche Fragen von dieser Sondersendung nicht beantwortet wurden:
„Wie wirkt sich das auf die Betriebe aus, der Kurssturz?
Was bedeutet das für unsere Arbeitsplätze?
Kommt jetzt die ganz große Krise der Weltwirtschaft?
Bricht vielleicht am Ende das Weltwirtschaftssystem zusammen?“
Die Antworten, sagte Theisen und entschuldigte sich dafür, musste sein „Brennpunkt“ den Zuschauern schuldig bleiben.
Die einzige Frage, die die Sendung tatsächlich beantwortete, lautete: Kommt Thomas Mayer, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der von der Redaktion offenbar mangels eigener Fachkenntnisse auserkoren war, all diese Fragen zu beantworten, noch im Laufe der Sendung zu Theisen ins Studio?

Die Antwort: Er kam nicht.
Der „Brennpunkt“ hatte mit einem Filmbericht begonnen, in dem ein Frankfurter Börsenmakler die Kurve des Dax in verschiedene Metaphern übersetzte. „Ich bin seit heute Anhänger von Sebastian Kneipp „, begann er, „Wechselbäder kalt und warm.“ (Lacher, Beifall oder ein närrisches Tätää wurden nicht eingespielt.) Der Mann fügte hinzu: „Es begann sehr positiv, weiß, dann wird es etwas schwieriger in den Märkten, grau, und zum Schluss muss man sagen, ist es dann doch noch ein schwarzer Montag geworden.“ Schön, dass einem endlich mal jemand diese komplexe Farbenmetaphorik erklärt hat.
Der Bericht endete mit einer Art Entwarnung. Der Sprecher sagte: „Es gilt die alte Börsenweisheit: Der Bulle schlägt den Bär – auf lange Sicht geht’s wieder nach oben.“
Im Anschluss setzte sich Alois Theisen ans Steuer des auf Hochtouren laufenden mobilen Bildergenerators: „Die Krise kam nicht mit einem großen Knall. Sie schleicht auf leisen Sohlen.“ Dann erklärte er, dass die negative Kursentwicklung eigentlich gar nicht der Lage der brummenden deutschen Wirtschaft und insbesondere der Automobilindustrie entspreche („Die Auftragsbücher sind voll“).
Es hätte ein Film darüber folgen sollen. Aber er kam nicht. Nach einigen Sekunden sagte Theisen:
„So, und der Beitrag liegt noch nicht vor. Es ist heute ganz hektisch. Unser Gesprächspartner, den wir hier im Studio haben wollten, den Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, ist auch noch nicht eingetroffen. Das ist Wahrscheinlich den Aufgeregtheiten, Nervositäten des Tages geschuldet. Wir hoffen noch.“
Zum Glück saß in New York schon die Korrespondentin Anja Bröker im ARD-Studio bereit, die Theisen körpersprachlich engagiert fragte, ob der Dow Jones immer noch weiter nach unten rutsche oder es ein Halten gebe. Sie hatte keinelei Hoffnung.

Nun wieder Theisen:
„Ja, und äh, was sagen denn die Fachleute an der New Yorker Börser, ist jetzt sozusagen die Schuldenkrise der Staaten, ist die jetzt in der realen Wirtschaft angekommen? Hat sich die Wirtschaft mit dem Bazillus infiziert?“
Das ist mal ein originelles Bild, das vielleicht ein klitzekleines Bisschen darunter leidet, dass die die, äh, Erkältung der Staaten nicht zuletzt daher rührt, dass sie so aufopferungsvoll alles dafür getan haben, die schwer verkühlte Wirtschaft dick einzupacken, und dafür die eigenen Mäntel und Schals opferte.
(Frau Bröker wies Herrn Theisen geduldig darauf hin, dass es der amerikanischen Wirtschaft sehr schlecht geht und sie sich nur extrem langsam erholt.)
In der Zwischenzeit war offenbar der Beitrag über die deutsche Wirtschaft fertiggeworden, und Theisen unterstrich deren „Brummen“ noch einmal mit einer Beckerschen Doppelfaust. Wort- und zahlenreich beschrieb der Film, wie unfassbar blendend es der deutschen Autoindustrie gehe und wie ungerecht es angesichts dessen sei, dass gerade deren Unternehmen besonders stark an der Börse verlören.
Zurück zu Alois Theisen:
„Ja, ist das alls nur Panik? Hat es mir der Wirklichkeit nichts mehr zu tun? Das würde ich jetzt gerne fragen Thomas Mayer, den Chefvolkswirt der deutschen Bank, der eigentlich zugesagt hatte, heute Abend hier bei uns zu sein. Noch ist er nicht eingetroffen. Vielleicht es ein Stau. Wir hoffen noch.“
Stattdessen erinnerte er die Zuschauer an den Beginn der Krise, den „verschleierten Bankrott“ Griechenlandes und die Politiker, die durch „Zaudern, Zögern und einen wirren Zickzack-Kurs“ in den Augen vieler Menschen zu „Versagern“ geworden seien. Immerhin habe sich die Krise um den Euro und die Staatsanleihen der hochverschuldeten europäischen Länder dank des Einschreitens der Europäischen Zentralbank nicht weiter verschärft, sagte Theisen, ein „kleiner Lichtblick an einem trüben Tag“ – und eine weitere Metapher im Bild:

„Sind es nur Kratzer an der Oberfläche? Oder ist der Euro auch in seinem Kern beschädigt?“
Zurück zu Theisen:
„Ja, ist das heute die Trendwende in der Schuldenkrise oder nur eine Atempause? (…) Die Märkte haben trotz des Lichtblicks bei den Staatsanleihen die Aktien weiter auf Talfahrt geschickt. Glauben sie den Politikern nicht mehr?“
Thomas Mayer, der all das hätte beantworten sollen, war immer noch nicht im Studio aufgetaucht, aber irgendjemand hatte nun offensichtlich entschieden, dass er es vermutlich in den restlichen fünf Minuten Sendezeit auch nicht mehr tun würde, und so zeigte der „Brennpunkt“ zwei Sätze, die Mayer vorher schon zum Thema in die Kameras des HR gesagt hatte.
Darauf Theisen:
„Ja, leider müssen wir ihnen weitere Antworten von Thomas Mayer schuldig bleiben. Er ist weiter nicht eingetroffen neben mir.“
Und so musste Frau Bröker in New York nochmal ran und wurde von Theisen einfach nochmal dasselbe gefragt:

„Was sagen denn die Experten an der Börse? Rutscht es heute noch weiter ab? Oder kann man davon sagen, die Börse in New York hat sich gefangen? Die Kurse geben nicht weiter nach? Haben wir am Ende des Tages vielleicht einen kleinen Lichtblick?“
Frau Bröker hatte auch jetzt keine aufmunterndere Antwort als fünf Minuten zuvor. Und so verabschiedete sich Theisen mit der oben zitierten Aufzählung sämtlicher Fragen, die dieser „Brennpunkt“ offen lassen musste, weil der einige Mensch auf der Welt, der sie nach Ansicht des Hessischen Rundfunks hätte beantworten können, nicht ins Studio gekommen war. Und fast möchte man diese Art von Journalismus loben, der nicht vorgibt, Antworten zu kennen. Aber es wäre doch schön gewesen, sich wenigstens mit den Fragen beschäftigt zu haben.