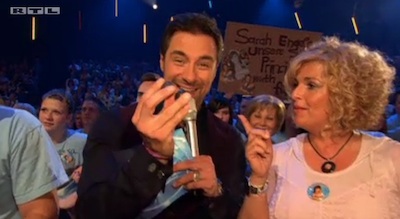Es hätte ein großer Abend werden können, gestern in der Düsseldorfer Tonhalle. Der WDR hatte geladen und sein Sinfonieorchester mitgebracht. Heldinnen und Helden der Grand-Prix-Geschichte wie Mary Roos, Ingrid Peters, Katja Ebstein und Johnny Logan waren gekommen, um die Klassiker aus dem Wettbewerb noch einmal live und im Orchester-Arrangement zu singen und sich feiern zu lassen, von der dankbaren, treuen Fangemeinde.

Es sind große, unvergessene Schlager: „Wunder gibt es immer wieder“, „Nur die Liebe lässt uns leben“, „Über die Brücke gehn“, „Aufrecht gehn“… Das Publikum sang begeistert mit, nahm raunend zur Kenntnis, was für eine coole Sau Nino de Angelo ist, der Toto Cutugnos „Insieme“ interpretierte, und freute sich über die groovende Swing-Nummer, die Guildo Horn aus Michelles „Wer Liebe lebt“ machte und die sogar Versatzstücke von Monty Pythons „Always Look On The Bright Side Of Life“ enthielt. Die Künstler strahlten, als hätten sie seit Jahren nicht mehr einen solchen Zuspruch erfahren (was womöglich stimmt), und ließen sich zu der frenetisch geforderten Zugabe überreden.
Es hätte ein großer Abend werden können — sogar trotz Ralph Morgenstern, der ihn zu moderieren versuchte — nostalgisch natürlich, aber mitreißend. Aber diese „Grand Prix Classics“ waren nicht nur ein Begleitprogramm zur Finalwoche in Düsseldorf; sie waren auch ein Gegen-Programm. Sie wurden zu einer Demonstration derjenigen, die sich gegen die Modernisierung sträuben, die der Wettbewerb in den vergangenen gut zehn Jahren erlebt hat und in deren Geist auch das Finale von Düsseldorf stattfindet. Sie sehnen sich nach dem zurück, was der Grand Prix einmal war, oder genauer: wozu sie ihn verklärt haben.
Das fängt schon an mit dem auch und insbesondere unter Journalisten nicht ausrottbaren Irrglauben, die Veranstaltung heiße erst seit kurzem „Eurovision Song Contest“. Dies ist die Schrifttafel zu Beginn des vermeintlichen „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ 1983 in München:
Warum es überhaupt besser sein soll, den Liederwettbewerb im Deutschen mit einem französischen Namen zu benennen, erklärt sich vermutlich aus der Ablehnung des Englischen als böse, böse Sprache, die alle anderen (und nicht zuletzt die deutsche) aufzufressen drohe.
Entsprechend die andere Klage, die immer wieder erklingt: Dass die Länder beim Grand Prix nicht mehr wie früher™ in ihrer Landessprache singen müssen. (Diese Regel galt übrigens keineswegs von Anfang an und gab es auch in den siebziger Jahren zeitweise nicht.)
Beim WDR-Abend in der Tonhalle verhedderte sich Katja Ebstein heillos beim Versuch, gegen das Singen auf Englisch zu plädieren.
Katja Ebstein: Ich finde, intelligente Menschen können auch gut auf deutsch singen. (Demonstrativer Recht-hat-sie-Beifall aus dem Publikum.) Auch wenn es nicht so geschmeidig ist wie das Englische. Wir wollen was erzählen. Und die Menschen, die da zuhören, zumindest in unserem Land, brauchen das Deutsche, weil sie dem Text der Geschichte sonst nicht folgen können. Und ich finde, wenn man die Beliebigkeit sieht – wir haben gestern mal reingeschaut, in diese Vorconteste da, die singen jetzt alle, ob Russen, Türken, wer auch immer, alles singt englisch. Kein Mensch hört mehr auf die Geschichten, weil die es ja gar nicht hören können, verstehen können, bis auf eine Zeile. Das ist zuwenig.
Ralph Morgenstern: Aber es ist doch ein internationaler Wettbewerb.
Katja Ebstein: Macht doch nichts.
Also, ich persönlich verstehe eventuelle Geschichten in den russischen, türkischen und aserbaidschanischen Beiträgen besser, wenn sie mir auf englisch erzählt werden statt in der jeweiligen Landessprache. Wenn Verständlichkeit das Argument wäre, wäre es ein Argument dafür, alle auf englisch singen zu lassen.
Natürlich hat Katja Ebstein Recht, wenn sie die Gefahr der Beliebigkeit anspricht. Natürlich ist es merkwürdig, wenn ein Land wie Aserbaidschan Beiträge schickt, die moderner, internationaler und, mutmaßlich, unaserbaidschaniger klingen als alle anderen im Wettbewerb. Aber sagt uns das nicht mehr über das Land und wie es sich der Welt darstellen will als ein aserbaidschanischer Chanson?
Wenn es – jenseits der unfreiwilligen Komik, die allein einen solchen Wettbewerb aber nicht über 55 Jahre am Leben erhalten hätte – etwas gibt, das den Eurovision Song Contest faszinierend macht, dann doch das: Dass man sehen kann, wie sich Künstler aus verschiedenen Ländern auf dieser Bühne präsentieren, und interpretieren kann, was das über diese Länder aussagt. Und während der Punktevergabe kann man auch noch spekulieren, warum wer wem Punkte gab, und was das wiederum über Europa aussagt.
Der Grand Prix lebt von seiner Vielfalt. Er ist für Länder wie Aserbaidschan und Armenien der Versuch, sich mithilfe von Popmusik als moderne Länder im westlichen Sinne darzustellen. Er ist für Länder wie Griechenland und die Türkei immer wieder ein Anlass, neue Verknüpfungen von traditionellen einheimischen Rhythmen mit internationalem Pop zu suchen. Die Franzosen kommen in diesem Jahr mit einem Tenor, der auf korsisch singt, und glauben, dass gerade das die perfekte Kombination ist um mal wieder weit vorne zu landen. Und wer weiß, womöglich haben sie recht? (Ich glaube nicht.)
Dieser Wettbewerb soll besser sein, wenn man den Ländern vorschreibt, in welcher Sprache sie zu singen haben, und möglichst auch noch, dass für uns exotische Völker gefälligst für uns exotisch klingende Musik von zuhause mitbringen müssen? Wie kleingeistig.
Es sind jedes Jahr viele merkwürdige Beiträge dabei, was kein Wunder ist, denn es handelt sich um einen merkwürdigen Wettbewerb. Ein europäisches Wettsingen — was für eine grandiose Quatschidee. Natürlich geht es dabei nicht nur um die Qualität von Musik (als ob die sich irgendwie objektiv messen ließe), es geht um Sympathien gegenüber Künstlern, Auftritten und Nationen, es geht um Entertainment und es geht darum, wer es schafft, den Funken überspringen zu lassen und die Herzen der unterschiedlichsten Menschen vor den Bildschirmen zu erreichen, und sei es nur für exakt drei Minuten.
Natürlich kann man sagen, dass diesem Großereignis jede Relevanz fehlt, aber trifft das nicht auf alle Unterhaltung zu, nicht zuletzt auf Fußball? Ich habe das schon vor über zehn Jahren mal in einen Artikel geschrieben, aber das Gefühl, es täglich wieder irgendwohin schreiben zu müssen. Der Grand Prix ist — wie Fußball — exakt so wichtig, wie man ihn nimmt:
Fußball ist unser Leben, und der Grand Prix auch. Nicht für dieselben Leute, klar, auch nicht für ganz so viele, aber doch. Der europäische Schlagerwettbewerb ist genau so unendlich wichtig wie eine Europameisterschaft. Und natürlich genau so unendlich egal. Aber erheben sich vor dem Endspiel oder nach einem 0:3 gegen Kroatien mahnende Stimmen, die sagen: „Regt Euch ab, ist doch nur Fußball?“ Also.
Aber ironischerweise kann man, wenn man ihn dann wichtig nimmt, den Grand Prix, viel Spaß haben. Oder, natürlich, sich in seiner eigenen Engstirnigkeit einmauern. Und so sitzen sie da, die alten Grand-Prix-Knacker in der Tonhalle in Düsseldorf, und jammern, dass alles nicht mehr so „gemütlich“ ist, wie es vor 40 Jahren war, als ob irgendetwas anderes noch so „gemütlich“ wäre wie vor 20, 30, 40 Jahren. („Gemütlich“ ist auch nicht das erste Wort, das mir einfiele, um etwa die Anmutung des Song Contest 1983 in München zu beschreiben). Sie klagen, dass es kein Orchester mehr gibt, was tatsächlich schade ist – andererseits aber auch nur reflektiert, dass moderne Musik heute nicht von Orchestern gespielt wird. Und überhaupt ist ihnen das alles nicht geheuer. Und dann kommt natürlich, wie immer, der Hinweis, dass es sich nicht um einen Sänger-, sondern einen Komponistenwettstreit handele. Das ist richtig, aber dem Publikum herzlich egal, und zwar immer schon. Ich glaube nicht, dass jemand anders als Lena 2010 mit „Satellite“ den Eurovision Song Contest gewonnen hätte.
Leider treffen die Nostalgiker und Dogmatiker bei denjenigen, die für den Song Contest von heute verantwortlich sind, umgekehrt auf ähnliche Ignoranz. Stefan Raab und seine Leute haben sich nach meiner Wahrnehmung noch nie besonders für die Historie dieses Wettbewerbs oder die ihn umgebene schwule Kultur interessiert, die wiederum ihnen nicht geheuer ist (von deren Tauglichkeit als Zielscheibe für Spott natürlich abgesehen).
Lena muss in diesen Tagen übrigens für diverse Einspielfilme der Produktionsfirma Brainpool Kartoffelsalat an die verschiedenen Delegationen verteilen. Der Gedanke, dass sie mit den anderen Sängerinnen und Sängern musizieren könnte, war offenbar zu abwegig.


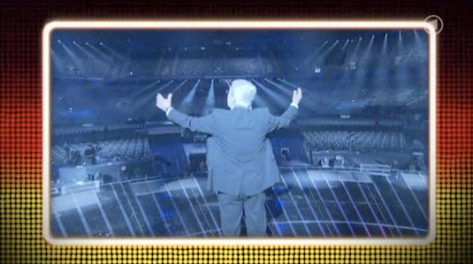




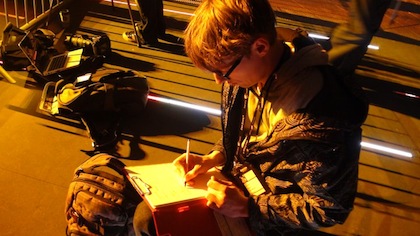

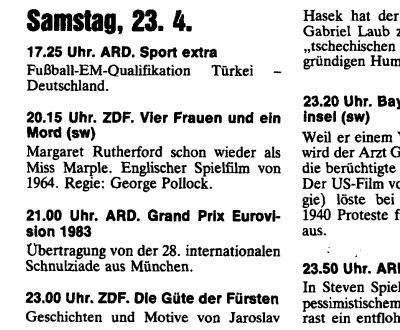

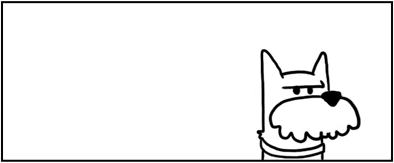
 Vor allem aber widerlegt die heutige „Bild“-Zeitung Lückeraths hoffnungsvolle These von der Selbstverständlichkeit.
Vor allem aber widerlegt die heutige „Bild“-Zeitung Lückeraths hoffnungsvolle These von der Selbstverständlichkeit.