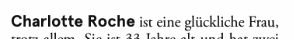Nach zwei Wörtern habe ich geahnt, dass mich der „Zeit-Magazin“-Artikel über den Umgang von „Bild“ mit Prominenten enttäuschen würde.
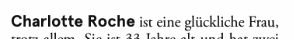
Ich verehre Charlotte Roche, und sie hat die „Bild“-Zeitung von ihrer verachtenswertesten Seite kennengelernt. Aber die Episode, wie ihr kurz nach einer Familientragödie von Leuten zugesetzt wurde, die sich als „Bild“-Mitarbeiter ausgaben, ist jetzt fast zehn Jahre her. Sie ist seitdem viele Male nacherzählt worden, unter anderem schon 2003 und 2005 im „Stern“ und 2004 im „Tagesspiegel“.
Natürlich kann man sie gar nicht oft genug erzählen, weil sie womöglich nicht nur krass ist, sondern auch typisch für die Art, wie die „Bild“-Zeitung sich Menschen gefügig zu machen versucht. Aber wenn ein Artikel im Jahr 2011 über den Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten mit einer zehn Jahre alten, vielfach erzählten Geschichte beginnt, spricht das nicht dafür, dass die Autoren etwas Neues herausgefunden haben. Es spricht leider sogar für die „Bild“-Zeitung, weil so der Eindruck entsteht, dass es nichts Neues gibt, das die Autoren hätten herausfinden können.
Leider bestätigen die über 4000 Wörter des Artikels das Gefühl, das die ersten zwei geweckt haben. Sein Personal besteht fast vollständig aus den Leuten, die seit mehr als einem halben Jahrzehnt in ungefähr jedem kritischen Artikel über die „Bild“-Zeitung vorkommen. Neben Charlotte Roche sind das vor allem der unvermeidliche Medienanwalt Christian Schertz und die Künstleragentin Heike-Melba Fendel („Barbarella Entertainment“).
Der „Zeit Magazin“-Artikel erwähnt natürlich auch die Geschichte von Sibel Kekilli. Der Versuch von „Bild“, sie zu vernichten, liegt nun auch schon sieben Jahre zurück. Aus dem „Zeit Magazin“ erfahre ich immerhin, was ich nicht wusste, dass es der Regisseur Dieter Wedel war, der ihr anlässlich der Dreharbeiten zu seinem Film „Gier“ geraten habe, wieder mit „Bild“ zusammenzuarbeiten. (Ausgerechnet von dem Mann, der damals als Unterhaltungschef für die widerliche Berichterstattung verantwortlich war, durfte oder musste sie sich dann in den Himmel hochschreiben lassen.)
Wenn man es nicht schafft, neue Beispiele für den bedenklichen Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten zu recherchieren, muss man vielleicht aufhören, Artikel über den bedenklichen Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten zu schreiben. Ich habe mich aus dem Geschäft der täglichen „Bild“-Beobachtung ein bisschen zurückgezogen, aber ich würde behaupten, es gibt diese Fälle, auch heute noch. Der Umgang von „Bild“ mit Judith Holofernes vor einigen Wochen war ein vergleichsweise harmloses, aber erhellendes Beispiel: Die Sängerin von „Wir sind Helden“ weigert sich, für „Bild“ zu werben, und „Bild“ nutzt ihre Absage, um für sich zu werben. Die sich als Medienjournalisten tarnenden Schaulustigen waren natürlich begeistert über den Schlagabtausch, aber wie bezeichnend ist das für die Unverfrorenheit von Kai Diekmann und seinen Leuten? Er respektiert nicht einmal den Willen eines Menschen, nicht als Werbefigur für sein Ekelblatt aufzutreten, und schmückt sich noch mit dem Dokument der Ablehnung.
Ich weiß nicht, warum sich deutsche Medien so schwer tun, sich mit handelsüblichen journalistischen Mitteln dem Phänomen der „Bild“-Zeitung zu widmen und — wie im Fall des „Spiegels“ vor einigen Wochen — in geradezu eigenrufschädigender Weise scheitern. Ich fürchte inzwischen, dass die meisten dieser Ausweise der Hilflosigkeit die „Bild“-Zeitung eher stärken als schwächen.

Die „Bild“-Geschichte ist Teil eines ganzen Themenheftes über Journalismus, und größere Teile davon sind nicht nur enttäuschend, sondern ärgerlich. Die Artikel wirken, als wollten sie beweisen, was im großen „Zeit“-Titelseiten-Teaser steht: „Im Kritisieren sind Medien gut — Selbstkritik fällt dagegen schwer.“
Unter der Überschrift „In eigener Sache“ berichten vier „Zeit“-Journalisten „aus unserer Praxis“. Es sollen wohl Bekenntnisse der eigenen Unzulänglichkeiten sein, des Scheiterns am großen Anspruch, die „Wahrheit“ zu berichten. Der Feuilleton-Redakteur Adam Soboczynski bekennt bei dieser Gelegenheit, dass er im Nachhinein Zweifel hat, ob sein Portrait über den Schriftsteller Gaston Salvatore wirklich perfekt war:
Das Porträt handelte also vom schwierigen Umgang der Deutschen mit einem Chilenen. Salvatore erzählte bei unserem Interview in Venedig, dass er bald einen Roman schreiben werde mit dem Titel „Der Lügner“. Er beabsichtige, den Roman auf Spanisch abzufassen, obgleich er lange Zeit beinahe ausschließlich auf Deutsch geschrieben hat. Mein Artikel Der Verdammte schloss also folgendermaßen: Salvatore habe jedenfalls die Absicht, bald einen Roman zu schreiben. Diesmal nicht auf Deutsch. Sondern auf Spanisch. Der Arbeitstitel laute: „Der Lügner“.
Das war keine Lüge. Und doch plagt mich eine leise innere Anklage. Am Ende des Artikels zu sagen, Salvatore schreibe nicht mehr auf Deutsch, legt nahe, dass er derart von den Deutschen enttäuscht sei, dass er darum auf Deutsch nicht mehr schreiben möchte. Das weiß ich, offen gesagt, gar nicht so genau. Ich weiß, dass es stimmt, dass er den Roman auf Spanisch und nicht auf Deutsch schreiben möchte. Aber vielleicht möchte er nur sozusagen zur Abwechslung mal auf Spanisch schreiben. Ich hatte das nicht erfragt. Ich gestehe.
Sind Sie noch wach?
Das ist es also, was „Zeit“-Redakteuren einfällt, wenn sie Selbstkritik üben sollen. Das wäre selbst uns Erbsenzählern zu piefig.
Sein Kollege Henning Sußebach berichtete, wie er eine Reportage über einen „Mann am Rande der Gesellschaft“ geschrieben hatte, einen „sogenannten Verlierer“. Es muss, glaubt man Sußebachs Beschreibung von Sußebachs Artikel, ein großartiger Artikel gewesen sein, einfühlsam, engagiert, mit ausführlichen Zitaten des Betroffenen. Das Problem mit dem Artikel war, bösartig zusammengefasst, dass er zu gut war.
[…] ich schrieb Sätze, die L. zwar nicht freisprachen von Schuld an seinem Schicksal, aber auch der Gesellschaft Verantwortung zurechneten. Schon um die Leser bei der Ehre zu packen. Bis heute bin ich der Meinung, dass das richtig war. Und doch habe ich L. damit keinen Gefallen getan.
Es klingt schrecklich arrogant: Aber für einen Menschen, für den sich jahrelang niemand interessiert hat, dessen bisheriges Leben geradezu aus Nichtbeachtung bestand, kann ein einziger Zeitungsartikel zu groß sein, zu gewaltig. (…)
Ich traf mich immer wieder mit L. und merkte: Aus allen solidarischen Sätzen meines Artikels hatte er sich eine Hängematte geknüpft, in die er sich fallen ließ. Keine Arbeit? Keine Wohnung? Kein Kontakt zu den Eltern? Nie war er verantwortlich, immer waren es die anderen. So hatte er meinen Artikel verstanden. (So verstand ich jetzt jedenfalls ihn.)
Als Sußebach seinem Berichtgegenstand L. später sagte, dass er selbst für sich verantwortlich sei, habe L. sich verraten gefühlt.
Da war er wieder, der Vorwurf: Erst heuchelt der Journalist Verständnis, und dann zeigt er sein wahres, zynisches Wesen. In diesem Fall stimmte das nicht. Genau das macht die Sache so tragisch.
Das ist das Tragische an der Geschichte? Dass ein armer „Zeit“-Journalist, der kein Zyniker ist, für einen Zyniker gehalten wird? So verdienstvoll es ist, wenn Journalisten sich Gedanken machen über die Folgen ihrer Arbeit: Das ist keine Selbstkritik, das ist Selbstmitleid.
Es durchzieht viele der kleinen Texte, auch die, in denen „Zeit“-Journalisten sich mit Leser-Kritik beschäftigen. Ressortleiter Jens Jessen erklärt in einer „kleinen Rede an die Verächter des Feuilletons“ (kein Dialog, wohlgemerkt, sondern eine „Rede an“), dass der Feuilletonist gar nicht anders sein kann als einen elitären Geschmack zu haben:
Die Kultur ist sein Gegenstand; und mit der Dauer der Beschäftigung wachsen die Ansprüche. Auch wer mit Edgar-Wallace-Krimis im deutschen Fernsehen begann, findet irgendwann Hitchcock besser.
Dieses Schicksal einer unwillkürlichen Erziehung des Geschmacks teilt der Feuilletonist aber mit seinem Publikum. Niemand, dessen Leidenschaft sich an der Literatur entzündet, bleibt bei Harry Potter stehen.
Wer „selten liest, ungern Musik hört und vom Kino nur den Schuh des Manitu erwartet“, dürfe aber „gerne umblättern“, gestattet Jessen großmütig.
Das ist eine Kunst: beim Reflektieren und Nachdenken so uneinsichtig und arrogant zu wirken. Und womöglich ist das alles sogar gut gemeint. Aber wenn diese „Zeit“-Redakteure über die Unzulänglichkeiten ihrer Arbeit und der Arbeit von Journalisten überhaupt reden, wirken sie wie ein Portraitmaler in der Fußgängerzone, der irgendwann zugibt, dass man, wenn ganz genau hinschaut, vielleicht doch kleinste Unterschiede zwischen seinen Strichzeichnungen und Fotos erkennen könnte.
Immerhin: Heike Faller hat für das Special in einem lesenswerten Artikel nachvollzogen, warum praktisch keine Zeitung vor der drohenden Finanzkrise warnte und, wichtiger noch: Warum die Mechanismen des Journalismus so sind, dass es auch beim nächsten Mal wieder so käme.
Aber das ist dann alles, was der „Zeit“ einfällt zum Thema „Was Journalisten anrichten“? Chefredakteur Giovanni di Lorenzo warnt im Video die „Zeit“-Leser, die vielleicht nicht wissen, dass außerhalb ihrer Wochenzeitung Medienjournalismus eine zwar ständig bedrohte, aber durchaus etablierte Disziplin des Journalismus ist, sogar davor, dass das, was man da gewagt habe, „ein bisschen an Nestbeschmutzung“ grenze.
Nein, das eigene „Zeit“-Nest hat man schön sauber gehalten. Die Redakteure haben sich nicht einmal den Hinweis verkniffen, dass in dem Roman „Ein makelloser Abstieg“, in dem Matthias Frings das Funktionieren der Boulevardpresse beschreibt, die „Zeit“ das Vorbild „für die seriöse Zeitung“ darstelle.
Als ein „recht selbstzufriedenes Blatt“ hat Oliver Gehrs das „Zeit Magazin“ im vergangenen Jahr — vergleichsweise milde — bezeichnet. Die übliche Gediegenheit der „Zeit“ wird beim Versuch, selbstkritisch zu sein, zu abstoßender Selbstgerechtigkeit. Vermutlich ist den Redakteuren wirklich beim besten Willen nichts eingefallen, was sie sich ernsthaft vorwerfen könnten.
Ich helfe fürs nächste „Journalismus-Special“ gerne mit zwei Thementipps aus. Vielleicht könnte die „Zeit“ ihren Lesern einmal die bizarre und höchst unjournalistische Rolle von Sabine Rückert erklären, die für die Zeitung über den Kachelmann-Prozess berichtet und dabei in einem Maße mit der Verteidigung verbandelt ist, die mindestens nach einer Offenlegung schreit, wenn sie sie nicht als Autorin in dieser Sache disqualifiziert.
Oder sie könnte die Gelegenheit nutzen, der interessierten Öffentlichkeit zu erklären, was es mit folgender Passage in einer Titelgeschichte nach dem Rücktritt von Karl-Theodor zu Guttenberg auf sich hatte:
In der CSU-Vorstandssitzung am Montagvormittag in München muss sich Guttenberg Sticheleien und zweideutige Sätze seiner Parteifreunde gefallen lassen. Vereinzelt verbreiten Journalisten bereits das Gerücht, es gebe einen Zusammenhang zwischen einer Textstelle in der Doktorarbeit und seiner sexuellen Neigung.
Das wäre doch mal ein Thema für das nächste Selbstkritik-Special der „Zeit“: Wie man als seriöse Wochenzeitung anderer Journalisten Gerüchte verbreitet, und zwar gerade vage genug, dass es richtig interessant klingt.
Aber mit etwas Pech fällt Adam Soboczynski bis dahin ein, dass man in einem seiner Portraits ein Komma falsch auslegen könnte, und das geht natürlich vor.