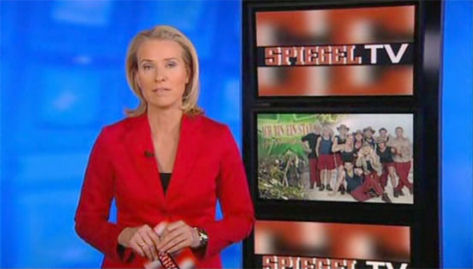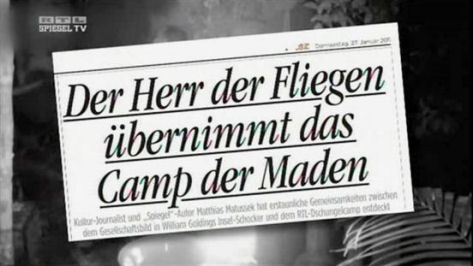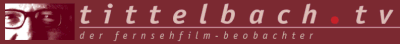Wenn die Dinge nicht gut laufen für Monica Lierhaus, wenn es Schwierigkeiten in ihrer Beziehung geben sollte oder Komplikationen bei ihrer Genesung, dann wird „Bild“ da sein. „Bild“ wird sich dann das Recht herausnehmen, die Öffentlichkeit auch an den Dingen teilhaben zu lassen, die die Moderatorin am liebsten für sich behalten würde. Und wenn Frau Lierhaus sich darüber dann beklagen sollte, dann wird sie sich vom Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG wohl als „Heuchlerin“ bezeichnen lassen müssen, als eine von denen, die „erst von der Plattform profitieren“ wollen und sich hinterher beschweren, „wenn’s mal unangenehm wird“.
Matthias Döpfner hat das Prinzip der „Bild“-Zeitung einmal so beschrieben:
„Wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen.“
Monica Lierhaus hat diese Entscheidung für sich getroffen. Und der Springer-Verlag hat ihr dafür, dass sie zu ihm in den Fahrstuhl gestiegen ist, eine ganz besonders prächtige Plattform geschnitzt. Sie besteht nicht nur aus einer Goldenen Kamera und der zugehörigen Bühne. Sie besteht auch aus einer großen, sehr angestrengt sensiblen Titelgeschichte in der „Bild am Sonntag“, mehreren Titelgeschichten in der „Bild“-Zeitung und der Verklärung von Frau Lierhaus zur vielleicht besten Moderatorin aller Zeiten.
Das ist ein zugegeben kleines, aber bezeichnendes Detail in der ganzen Heuchelei: Warum genügt es nicht, Monica Lierhaus für ihre Lebensmut zu bewundern und zu feiern, für die Kraft, die es gekostet haben muss und noch kosten wird, die Folgen ihrer Erkrankung zu überwinden. Warum genügt es nicht, dass sie eine beliebte Moderatorin war und ist? Warum muss sie nachträglich die beste werden?
Stefan Hauck schreibt in „Bild am Sonntag“:
Wegen ihrer Art, sich vor der Kamera zu präsentieren, hat Monica Lierhaus, geboren 1970 in Hamburg, eine Menge Männer zunächst verrückt gemacht und gelegentlich auch ein bisschen garstig; aber die allermeisten Männer akzeptierten schließlich, dass dieser rothaarigen Frau praktisch nie ein Fehler unterlief. Egal ob sie mit Fußballern sprach, mit Radfahrern oder mit Wintersportlern.
Hauck ist offenbar der Grund, warum sich Monica Lierhaus und ihr Lebensgefährte die „Bild am Sonntag“ als das Medium ausgesucht haben, dem sie all das erzählten, was zwei Jahre lang niemand wissen sollte und schreiben durfte. Hauck begleitet das Wirken von Lierhaus schon seit Jahren mit freundlichen Texten und Interviews. Am vergangenen Sonntag machte er aus ihrem Leben einen Rosamunde-Pilcher-Roman.
Stefan Hauck kann auch anders. Vor fünfeinhalb Jahren richtete er einen damals ohnehin schon am Boden liegenden Fernsehmoderator publizistisch hin, nannte dessen Leben „erbärmlich“ und bedeutungslos, mokierte sich über die angeblich überschaubare „Summe seiner Begabungen“ und erweckte den Eindruck, dass der Mann es verdient hatte, einer Vergewaltigung angeklagt zu sein, selbst wenn er unschuldig sein sollte.
Haucks Charakterlosigkeit ist ein Grund, warum sein Lierhaus-Text so eklig ist. Die Charakterlosigkeit der Zeitungsgruppe, für die er arbeitet, ist ein anderer. Vor zwei Jahren ignorierte „Bild“ den ausdrücklichen Wunsch und das unbestrittene Recht von Lierhaus‘ Umfeld, Details ihrer Erkrankung geheim zu halten. Hauck verbirgt diese Tatsache in folgender Formulierung:
Man kann das jetzt ruhig ein bisschen ausführlicher erzählen, weil Monica Lierhaus seit fast zwei Jahren kein freiwilliges Wort darüber verlieren wollte, was in all der Zeit mit ihr und ihrem Leben geschehen ist.
Es ist mit der Konjunktion „weil“ und der verblüffenden Formulierung „kein freiwilliges Wort“ ein Satz, an der ganze Linguistik-Klassen ihre Freude haben können. Und Psychologen natürlich. Er verbindet den Hauch einer Andeutung, dass der Wille der Betroffenen bei so etwas in Haucks Kreisen nicht für entscheidend betrachtet wird, mit dem Stolz, trotzdem die Exklusiv-Geschichte bekommen zu haben.
„Bild“-Leute sind wie Tiere, die sich nicht selbst im Spiegel erkennen. Hauck schreibt:
Monica Lierhaus möchte [in Zukunft] ein Spiel im Stadion besuchen und sie hofft, dass sich die Fotografen dann auf die Spieler auf dem Rasen konzentrieren. Und nicht darauf, wie schnell sie, die Zuschauerin, die Stufen zu ihrem Platz hochsteigt.
Für welche Zeitungen mögen solche Fotografen arbeiten? Und wo mögen wohl die Artikel erscheinen, die interpretieren, wie schnell oder langsam, behende oder ungelenk, Frau Lierhaus inzwischen die Treppe hinaufsteigt?
Gut, womöglich ausnahmsweise nicht in „Bild am Sonntag“ und auch nicht in „Bild“, weil Frau Lierhaus jetzt eine besondere Freundin des Hauses ist und diese Zeitungen nicht undankbar sind, jedenfalls nicht, solange sich das lohnt.
Irgendwo stand, dass Lierhaus und ihr Lebensgefährte hoffen, dass sich dadurch, dass sie das Private der vergangenen zwei Jahre jetzt so spektakulär öffentlich gemacht haben, das Interesse des Publikums schnell wieder allein auf ihre Arbeit konzentrieren wird. Was für eine Illusion. In Zukunft wird sich jeder Boulevardreporter beim Blick in ihr Privatleben darauf berufen können, dass sie selbst die Tür dazu einmal weit aufgemacht hat.
· · ·
Monica Lierhaus hatte das Recht, Berichte über ihre Krankheit und ihre Genesung zu untersagen. Und sie hat das Recht, ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit so spektakulär zu inszenieren, wie sie es möchte. Das ist nicht nur juristisch gemeint: Womöglich war es genau die Kombination der erzwungenen Stille vorher mit der maximalen Lautstärke jetzt, die ihr hilft, den Weg ins Leben und in den Beruf zurück zu finden — wer wollte darüber urteilen?
Und doch stellt sich bei aller Sympathie ein merkwürdiges, irrationales und etwas unfaires Gefühl ein: Die Erkennbarkeit einer Inszenierung, die Offenkundigkeit eines Deals mit Springer, die Berechnung, die hinter all dem steht, lässt den Zuschauer und Leser zu einem Teil des Plans werden, ebenso wie übrigens das Publikum im Saal. Das Erzwingen des Schweigens vorher wirkt im Nachhinein so nicht als Grundrecht, sondern fast als dramaturgischer Kniff, um den Überraschungseffekt beim Wiederauftritt auf der Bühne noch größer werden zu lassen.
Das ist kein gutes Gefühl.
· · ·
Und dann war da noch der öffentliche und womöglich unabgesprochene Heiratsantrag von Monica Lierhaus. Erstaunlicherweise scheint das für viele Beobachter der eigentlich grenzwertige Moment der Inszenierung gewesen zu sein — entweder aus dem Gefühl heraus, dass das einfach ein Zuviel der Emotionen für einen einzelnen Fernsehmoment gewesen sei, oder weil sowas nun wirklich nicht in die Öffentlichkeit gehöre.
Das begreife ich nicht. Eine Ehe ist doch nicht zuletzt ein äußeres Bekenntnis von zwei Menschen, zusammen zu gehören. Warum soll es ausgerechnet eine Grenzüberschreitung darstellen, das dazugehörige, leicht anachronistische Ritual öffentlich zu zelebrieren (noch dazu, da es seit vielen Jahren in diversen Varianten zum festen Repertoire und zur Folklore des Fernsehens gehört). Die Gefahr ist hier höchstens die, dass der Moment abgeschmackt erscheint – aber zu intim? Eine prominente Frau erscheint nach zwei Jahren wieder in der Öffentlichkeit, in vielerlei Hinsicht gezeichnet von einer schweren Krankheit, und die Zumutung soll sein, dass sie ihrem Freund einen Heiratsantrag macht?
Das „Hamburger Abendblatt“ hatte sogar die euphemistisch als originell zu bezeichnende Idee, sicherheitshalber bei Moritz Freiherr Knigge nachzufragen, ob so was überhaupt statthaft ist. Der antwortete (mutmaßlich allen Ernstes) auf die Frage, ob sich Lierhaus den Antrag hätte verkneifen sollen:
Nein. Ein Heiratsantrag ist zwar etwas sehr Intimes, ebenso wie eine schwere Krankheit.
Das ist unglücklich formuliert. Knigge fügt hinzu:
Doch Monica Lierhaus ist nicht nur eine öffentliche Person, sondern eine sehr beliebte und respektierte obendrein.
Sehr beliebte und respektierte Personen können also ruhig öffentliche Heiratsanträge machen. Sie können sogar — möchte man angesichts der Parallele, die Knigge aufgemacht hat, hinzufügen — trotz erkennbarer Behinderung im Fernsehen auftreten, ohne dass es die Zuschauer zu sehr stört.
Vielleicht stürzt sich ein Teil der öffentlichen Diskussion auch deshalb auf die Frage nach der Zulässigkeit des Heiratsantrages, weil die andere Frage so viel unbequemer wäre: Wie behindert darf jemand sein, der im Fernsehen als Moderator arbeiten will?
Am Dienstag machte „Bild“ groß mit der Meldung auf, dass Monica Lierhaus jetzt „Ein Platz an der Sonne“ „macht“. „Botschafterin“ der ARD-Fernsehlotterie soll sie werden, Nachfolgerin von Frank Elstner. Später stellte die ARD dann klar, dass sie die Sendung nicht moderieren wird, das mache vorerst weiterhin Elstner. Was genau Lierhaus tun werde, stehe noch nicht fest. So sehr eine schwer sprechende, sich mühsam bewegende Monica Lierhaus die Menschen bewegte, so schwer wird sie dem Publikum im Alltag zu vermitteln sein — ich fürchte, die Frage, wann sie fit genug ist, wieder als Moderatorin zu arbeiten, hängt nicht nur von ihrem eigenen Urteil ab.
Als Behinderte darf Monica Lierhaus Fernsehbotschafterin für Behinderte werden. Das ist schön für sie. Und schrecklich typisch.
Es gibt eine Moderatorin mit sichtbarer Behinderung im deutschen Fernsehen: Bettina Eistel. Die Contergan-geschädigte Reiterin moderiert die wöchentliche Sendung „Menschen — das Magazin“ über die sozialen Projekte, die die ZDF-Fernsehlotterie unterstützt. Für die Redaktion sind ihre „Professionalität und Ausstrahlung die entscheidenden Kriterien für ihren Einsatz als Moderatorin — und nicht die Behinderung“, heißt es auf der Homepage der Sendung. Tatsächlich ist Eistel einfach eine gute Moderatorin. Aber die Frage ist: Warum gibt es keine andere Sendung, die sich allein auf die Kriterien Professionalität und Ausstrahlung verlässt? Warum ist für alle Sendungen außer denen, in dem es auch um Behinderte geht, Nicht-Behinderung ein entscheidendes Kriterium? Würden die Zuschauer, würden wir das nicht aushalten?
Wenn es beim Comeback von Monica Lierhaus nicht nur um Monica Lierhaus und das gute oder nicht so gute Gefühl gehen soll, das wir dabei haben, wäre das ein Thema, über das es sich lohnte zu diskutieren.
Aber möglichst ohne Ernst Elitz. Der Mann, der sich immer als „Gründungsintendant des Deutschlandradios“ bezeichnen lässt und zum „Bild“-Leitartikler geworden ist, behauptet heute in der „Frankfurter Rundschau“:
Lierhaus hat am Ort des schönen Scheins die Wahrheit verkündet: Wer von Krankheit gezeichnet ist, muss kein Verlierer sein.
Nein. Genau das ist der schöne Schein.


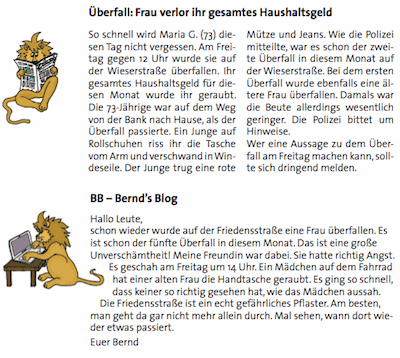
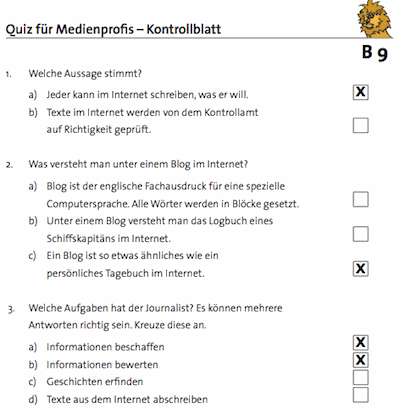
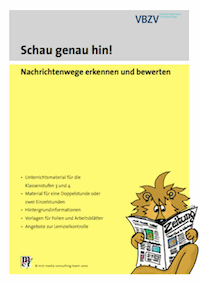 „Schau genau hin!“ heißt die Lerneinheit. Zu ihren ehrenwerten Zielen gehört es, dass die Kinder (jedenfalls im Internet) auf den Urheber einer Nachricht achten sollen, um die Glaubwürdigkeit von Informationen bewerten zu können. „Firmen verfolgen eigene Interessen“, warnt das Begleitmaterial, „und werden vor allem sich selbst oder ihre Produkte ins rechte Licht rücken.“
„Schau genau hin!“ heißt die Lerneinheit. Zu ihren ehrenwerten Zielen gehört es, dass die Kinder (jedenfalls im Internet) auf den Urheber einer Nachricht achten sollen, um die Glaubwürdigkeit von Informationen bewerten zu können. „Firmen verfolgen eigene Interessen“, warnt das Begleitmaterial, „und werden vor allem sich selbst oder ihre Produkte ins rechte Licht rücken.“