Neulich schrieb ein Mann, der früher an prominenter Stelle für „Bild“ gearbeitet hat, eine Mail an BILDblog. Es ging um einen Eintrag, inzwischen zwei Jahre alt, in dem wir ihm vorwerfen, einen Artikel anderswo abgeschrieben zu haben. Angeblich hatte das Plagiat (oder seine Aufdeckung) Folgen, jedenfalls endete die Zusammenarbeit mit „Bild“ wohl wenig später. Nun arbeitet der Mann frei und leidet. Er fragt uns:
Könnten Sie den Artikel aus ihrem Archiv löschen? Es wäre nett, da ich bei jedem Bewerbungsgespräch auf Bildblog angesprochen werde. Das mag Sie stolz machen, für mich ist das Ganze aber inzwischen existenzgefährdend.
Macht mich das stolz? „Stolz“ ist das falsche Wort, aber, zugegeben: Es ist ein gutes Gefühl, wenn die eigene Arbeit Wirkung zeigt und wenn sie nicht flüchtig ist. BILDblog hat immer eher darauf abgezielt, die Rezeption der „Bild“-Zeitung zu verändern als die „Bild“-Zeitung selbst — schon weil wir uns nicht vorstellen konnten, die „Bild“-Zeitung zu verändern. Gerade deshalb ist es immer wieder etwas besonderes, wenn wir auf irgendeinem Weg erfahren, dass unsere Arbeit
gelegentlich Folgen hat für die Leute von „Bild“. Es nimmt ein winziges Bisschen von der Macht von „Bild“.
Vor vier Jahren schrieb uns einmal ein Ressortleiter von „Bild“ wegen eines Eintrags, in dem es um ein angeblich exklusives „Bild“-Interview ging, dessen Inhalt erstaunlicherweise wörtlich mit einer Pressekonferenz zwei Tage zuvor übereinstimmte. Der Ressortleiter beklagte sich, dass die Mitarbeiterin wegen unseres Eintrages nun dauernd von Kollegen und Bekannten darauf angesprochen würde und sich rechtfertigen müsse. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass uns das bestürzt.
Sollen sie sich wenigstens erklären müssen.
Aber wie weit geht das? Was, wenn ein alter BILDblog-Eintrag wirklich existenzgefährdend für einen ehemaligen „Bild“-Mann ist? Im konkreten Fall ist das schwer vorstellbar, aber auch nicht auszuschließen.
Es ist eine merkwürdige Sache mit dem Internet, das von so vielen Leuten, nicht zuletzt Verlagsmanagern, behandelt wird, als wäre es ein flüchtiges Medium. Wäre der Artikel über das Plagiat des ehemaligen „Bild“-Mannes in einer Zeitung erschienen, wäre er heute zwar nicht unauffindbar, aber gut genug versteckt, um in Vergessenheit zu geraten. So taucht er schon bei einer flüchtigen Google-Suche nach dem Namen des Mannes weit vorne auf. Andererseits erscheint dabei auch noch ein bizarr lobhudelnder Bild.de-Artikel über ihn — anscheinend
geht es ihm nicht darum, diese ganze Periode seines Schaffens vergessen zu machen, sondern nur den heute lästigen Teil.
Ich weiß nicht, warum es ihm offenbar unmöglich ist, potentiellen Arbeit- oder Auftraggebern zu erklären, wie das damals passiert ist.
Vielleicht wird es noch einige Zeit dauern, bis wir uns alle an diese Nebenwirkung des Internets gewöhnt haben, dass es plötzlich ganz leicht ist, Dinge über uns herauszufinden, von denen wir wünschten, sie wären in Vergessenheit geraten, nicht nur die peinlichen Party-Fotos, auch die journalistischen Fehltritte. Das wird normaler werden und Personalchefs werden damit umgehen können. Andererseits gibt es journalistische Fehltritte, die auch nicht jeder gemacht hätte, auch nicht als Jugendsünde.
Totale Erinnerung ist nicht unbedingt ein Segen. Ich halte es durchaus in einigen Fällen für richtig, Namen aus kritischen Blog-Einträgen zu löschen — wenn mir die dauerhafte Form der Bestrafung, die damit verbunden sein kann, unangemessen erscheint.
Es wäre sicher auch falsch, so gnadenlos zu sein, wie es die „Bild“-Zeitung sicher bei ähnlichen Fragen wäre. Aber warum sollten ausgerechnet Menschen, die sich dafür entschieden haben, für ein skrupelloses Lügenblatt wie „Bild“ zu arbeiten, besondere Rücksichtnahme bekommen, wenn sich das im Nachhinein als nicht in jeder Hinsicht karrierefördernd herausstellt?
Manche Fälle finde ich trotzdem einfacher zu entscheiden als diesen.
Vor ein paar Monaten schrieb ein Moderator, der mehrere Jahre lang im Fernsehen Zuschauer mit irreführenden Versprechungen dazu animiert hat, ihr Geld für zweifelhafte Anrufsendungen auszugeben. Wenn man heute seinen Namen bei Google eingibt, steht an erster Stelle ein Eintrag aus diesem Blog, in dem die Frage diskutiert wird, ob Leute wie er sich womöglich des Betruges strafbar gemacht haben.
Das ist für ihn nicht ganz ideal, also schrieb mir der Mann:
Wäre es von Ihrer Seite aus möglich meinen Namen aus diesem Blog herauszulöschen?
So wie Sie die Dinge hier darstellen, wird mein Name mit Betrug in Verbindung gebracht, dass nicht gerade ruffördernd für mich ist. (…)
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie es besonders klasse fänden, wenn Ihr Name unnachweislich mit Betrug in Verbindung gesetzt wird und Sie somit bei Suchmaschinen als erstes in dem Zusammenhang auftauchen würden.
Es folgte später eine Abmahnung, in der es hieß:
Den Zuschauern der gegenständlichen Sendungen (…) sind die Namen der Moderatoren weder bekannt, noch sind diese für die Zuschauer von Interesse. Insoweit besteht lediglich ein Bedürfnis der Allgemeinheit, über das Geschäftsgebaren des Senders und dessen rechtliche Einordnung informiert zu werden. (…)
Dem Informationsinteresse und ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung steht das Persönlichkeitsrecht der jeweiligen Moderatoren entgegen, deren Namensnennung in ihren Beitrag für mögliche Auftrag- und Arbeitgeber unmittelbar in Zusammenhang mit der Verwirklichung eines Straftatbestandes gebracht wird.
Immerhin wird das Motiv der Abmahnung deutlich formuliert: Auch diesem Mann erschwert das, was er früher gemacht hat, nun die Jobsuche.
Mein Anwalt musste eine Antwort formulieren, dann habe ich nichts mehr von der Sache gehört. Ob der Moderator vergeblich versucht hat, eine einstweilige Verfügung gegen mich zu erwirken, weiß ich nicht.
Das ist die andere Seite dieses merkwürdigen Mediums: Es bleibt zwar viel für die Ewigkeit erhalten, aber die Leute glauben, sie können das, was ihnen nicht gefällt, einfach entfernen lassen. Teilweise haben sie damit sogar Erfolg, wie der Fall eines Hamburger Geschäftsmanns gezeigt hat.
Bei der Diskussion um den „digitalen Radiergummi“ geht es vor allem um irgendwelche Dokumente, die man einmal von sich ins Netz gestellt hat und von denen man sich wünschte, sie wären nicht mehr da. Aber wie ist das mit ganzen Teilen der eigenen Biographie? Kriminelle haben in gewissem Rahmen ein Recht auf einen Neuanfang und auf die Chance, dass ihre Taten nach Verbüßung der Strafe in Vergessenheit geraten. Aber die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und dem Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit ist außerordentlich knifflig, wie der Fall der beiden Männer zeigt, die wegen des Mordes an dem Schauspieler Walter Sedlmayr verurteilt wurden und seit einiger Zeit versuchen, ihre Namen aus den Online-Archiven zu klagen. Der Bundesgerichtshof wies ihre Unterlassungsforderung zurück — wollte daraus aber keine pauschale Regel ableiten.
Müssen auch ehemalige Call-TV-Moderatoren eine Chance zur Resozialisierung bekommen? Und bin ich dazu verpflichtet, ihnen dabei zu helfen?
Der österreichische Informationstheoretiker Viktor Mayer-Schönberger sagt:
„Vergessen und vergeben sind ungemein wichtig. Wer sich der Erinnerung an eigene Fehler oder die der anderen nicht entledigen kann, räumt der Vergangenheit zu viel Macht ein. Nur durch Vergessen können wir uns von alten Verhaltensmustern frei machen. Das schafft Raum für neue Ideen, lässt Individuen und ganze Organisationen wachsen und sich weiter entwickeln.“
„Vergessen“ und „vergeben“ sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, und bei ersterem bin mir nicht so sicher, dass Mayer-Schönberger recht hat. Natürlich lässt es, zum Beispiel, eine Fernsehmoderatorin, die heute beim Evangelischen Rundfunk die christliche Talkshow „Gott sei Dank“ präsentiert, leichter „wachsen und sich weiter entwickeln“, wenn sich niemand mehr daran erinnert, dass sie vorher als Animateurin beim sehr unchristlichen Call-TV gearbeitet hat.
Aber führt es nicht, umgekehrt, oft zu wünschenswerteren Entscheidungen, wenn Menschen davon ausgehen müssen, dass das, was sie tun, nicht hinterher gleich wieder vergessen ist? Es geht nicht darum, dass Menschen keine Fehler machen dürfen oder ihr Leben lang unter Jugendsünden leiden sollen. Es geht auch nicht um einen allumfassenden Pranger. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun — ganz besonders, wenn dieses Tun, wie bei Journalisten, in der Öffentlichkeit und genau genommen sogar für die Öffentlichkeit geschieht.
Es gibt dazu letztlich keine Alternative. Die merkwürdigen technischen Konstruktionen, mit denen dem Internet das Vergessen beigebracht werden soll, werden nicht funktionieren — außer, womöglich, für diejenigen, die die schlechtesten Motive und die größten Mittel haben.
Wir werden lernen müssen, mit all dem ungewollten Informationsgerümpel über uns zu leben, und deshalb werden wir es lernen, die vielen Dinge einzuordnen, die wir plötzlich mühelos über andere Leute herausfinden. Wir müssen sie dazu nicht vergessen oder vergessen machen.
Diese theoretisch-philosophische Frage bekommt natürlich eine ganz andere Ebene, wenn man selbst plötzlich derjenige ist, der dafür sorgen könnte, dass jemand nicht mehr bei jedem Vorstellungsgespräch auf die Geschichte angesprochen wird, die in einem BILDblog-Eintrag steht, die der dritte Treffer ist, wenn man bei Google nach seinem Namen sucht.
Eine grundsätzliche und allgemeingültige moralische Antwort, wie mit Löschwünschen zu verfahren sei, habe ich nicht. Wenn man weder gnadenlos sein noch seine Arbeit pauschal mit einem Verfallsdatum versehen will, bleibt wenig übrig, als sich in jedem einzelnen Fall ein Urteil zu bilden, das einem gerecht erscheint.
Im Fall des ehemaligen „Bild“-Journalisten vom Anfang haben wir uns dafür entschieden, seinen Namen nicht zu löschen.


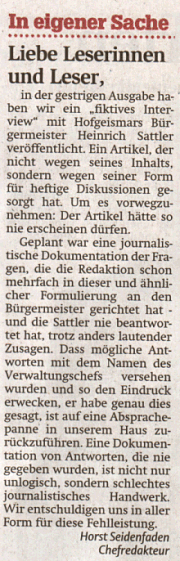 Nicht alle waren amüsiert. Und am nächsten Tag entschuldigte sich der Chefredakteur:
Nicht alle waren amüsiert. Und am nächsten Tag entschuldigte sich der Chefredakteur: