Dass die Gema böse ist, weiß jedes Kind. Und wenn nicht, erfährt es in diesen Tagen davon, wenn ihm seine Zeitung lesenden Eltern die Geschichte erzählen, wie diese fiesen Bürokraten aus München jetzt auch noch dem gemeinsamen Singen von Kinderliedern den Garaus machen wollen. Die Kindergärten sollen dafür zahlen, dass sie Notenblätter kopieren.
Das Land ist erschüttert. Aber nicht überrascht. Die Gema halt.
Die Geschichte ist nicht neu. Das sonst sehenswerte BR-Magazin „Quer“ hatte schon Mitte Oktober unter dem Titel „Gema kassiert bei Kindergärten“ auf die Tränendrüsen gedrückt. Passend zu den Martinsumzügen im November drehte das Thema erneut eine kleine Runde durch die Medien. „Gema will bei Kitas abkassieren“, titelte der „Berliner Kurier“ und sprach vom „Behörden-Irrsinn“. Und nun, in der kuscheligen, nachrichtenarmen Weihnachtszeit, ist die Stimmung genau richtig, um den Volkszorn noch einmal richtig anzuheizen. Die großen Boulevardmedien wie „Bild“ und „Spiegel Online“ sind in das Thema eingestiegen. „Bürokratie-Irrsinn in deutschen Kitas“, schreit „Bild“: „Die Verwertungsgesellschaft GEMA fordert eine Kinderlieder-Gebühr!“
Das ist natürlich Unsinn. Zunächst einmal steckt hinter den Forderungen nicht die Gema, sondern die VG Musikedition. Sie vertritt Komponisten, Texter und Verlage und nimmt deren Rechte in Bezug auf die Vervielfältigung ihrer Werke vor allem in Form von Noten wahr. Die VG Musikedition hat nur das Inkasso an die ungleich größere Gema abgegeben. Von einer „Gema-Gebühr“ zu schreiben, wie es auch halbseriöse Meediendienste tun, ist falsch.
Die Gema hat im Auftrag der VG Musikedition mehrere zehntausend Kindergärten angeschrieben und auf die Gesetzeslage hingewiesen: Das Kopieren von Noten ist in Deutschland streng verboten. Es gibt dafür nur wenige Ausnahmen, und es gibt — anders als beim Vervielfältigen von Tonträgern — auch kein Recht auf eine Privatkopie.
Viele Kindergärten haben die Post der Gema als Mahnung empfunden. Von der Gema war sie dagegen als Angebot gemeint, eine rechtlich zweifellos unzulässige Praxis zu legalisieren: Für 56 Euro jährlich können die Kindergärten eine Lizenz erwerben, die es ihnen erlaubt, bis zu 500 Kopien anzufertigen. Die Gema meint, das sei ein Fortschritt, weil bislang nur der Kauf einer entsprechenden Zahl von Notenbüchern eine legale Lösung gewesen sei.
Das Thema betrifft nur vorschulische Einrichtungen und zum Beispiel keine allgemeinbildenden Schulen, weil die über die Bundesländer einen Pauschalvertrag mit der VG Musikedition abgeschlossen haben, durch den das Kopieren von Noten — in einem engen Rahmen — vergütet wird. Verhandlungen über einen ähnlichen Vertrag auch für die Kindergärten sollen geführt werden, sind aber wegen der Vielzahl unterschiedlicher Träger schwierig.
Man kann das Vorgehen der Gema oder der VG Musikedition unsensibel oder ungeschickt finden. Aber schuld an den Forderungen sind nicht sie, sondern ein 25 Jahre altes Gesetz. Vielleicht könnte das jemand den Politikern sagen, die sich gerade drängeln, noch einen Platz zum Fahneschwenken auf dem Kinderlieder-Rettungszug zu ergattern.
Sibylle Laurischk (FDP), die Vorsitzende des Familienausschusses im Bundestag, lässt sich von „Bild“ mit dem Satz zitieren: „Singen in Kitas gehört zur Grundbildung!“ — als wollte die Gema den Kindern das Singen verbieten. Das Familienministerium soll laut „Bild“ gefordert haben, die Probleme mit der Gema so schnell wie möglich zu klären. Die Probleme mit der Gema? Und der saarländische SPD-Vorsitzende Heiko Maas brachte seine Existenz in Erinnerung mit der Formulierung, es handele sich um „Abzocke im Kindergarten“. Gerade das gemeinsame Singen im Kindergarten sei ein Ausdruck unbeschwerter Kindheit, sagte er ohne offenkundigen Zusammenhang. Jahrzentelang habe dies problemlos funktioniert.
Noch einmal: Vielleicht könnte jemand diesen Politikern sagen, dass das deutsche Urheberrecht das Kopieren von Noten verbietet, auch in Schulen und Vorschulen. Und vielleicht könnten es Journalisten sein, die diese Aufgabe übernehmen?
Natürlich nicht. Denn sie sind damit beschäftigt, der ahnungs- und atemlosen Erschütterung der Kita-Mitarbeiter Ausdruck zu verleihen. Offenbar bedeuten 56 Euro Mehrkosten jährlich für die meisten von ihnen den sicheren Ruin. Überhaupt ist es erstaunlich, wie viele Kinder im Vorschulalter anscheinend schon lesen können. „Wir müssen mit den Kindern jetzt (…) mehr proben als früher“, zitieren die „Elmshorner Nachrichten“ die Leiterin der Tagesstätte Krückaupark. „Diese Zeit fehlt für andere Dinge.“ Auch an der Hi-Ha-Hermann-Kita heißt es, neben Erziehern und Eltern müssten auch die Kinder wegen des Kopierverbotes mehr auswendig lernen als früher. Stefan Raab kann keine Noten lesen, aber die versammelten Drei- bis Sechsjährigen Elmshorns haben die Lieder bislang vom Blatt gesungen?
Das „Hamburger Abendblatt“ schließlich lässt die Vorsitzende des Vereins Dago Kinderlobby mit der originellen Einschätzung zu Wort kommen: „Alles, was Kinder nicht verstehen, ist auch sozial nicht verträglich.“ Offenbar ist keine Meinung zu bekloppt.
Die Position der meisten deutschen Medien lässt sich schon aus Überschriften wie „Süßer die Kassen nie klingeln“ und dem regelmäßig benutzten Wort „abkassieren“ leicht erraten.
Bei Stern.de hat man gar nicht verstanden, worum es geht, und schreibt: „Als hätten deutsche Kindergärten nicht schon genug Sorgen. Die Gema fordert Gebühren fürs öffentliche Singen.“ (Es geht, um es noch einmal zu sagen, ums Kopieren von Notenblättern.)
Das „Hamburger Abendblatt“ sieht in einer Glosse gleich das Ende des Gesangs gekommen:
Die Gema schaltet die Kinder stumm. Stille Nacht – endlich einmal wirklich. Gema sei Dank.
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ macht sich mit beißender Ironie über das Vorgehen der Gema lustig (der eigentlich entscheidende Name „VG Musikedition“ fällt auch hier nicht):
Kinder können ja gar nicht früh genug lernen, dass es im Leben nun einmal nichts umsonst gibt, nicht einmal Kinderlieder. (…) Natürlich müsste regelmäßig überprüft werden, ob all diese Listen korrekt geführt werden. Außerdem ist unbedingt sicherzustellen, dass die in den Kindergärten erstellten Kopien von Liedtexten ihrerseits kopiergeschützt sind, sonst singen sich die kleinen Verbrecher am Ende noch zu Hause vom raubkopierten Blatt was ins Fäustchen, weil sie glauben, das käme sie billiger.
Dieser Spott ist eine erstaunliche Position für eine Zeitung, die — wie die meisten anderen — bislang mit großem Ernst und großer Einseitigkeit dem radikalen Schutz ihres eigenen sogenannten geistigen Eigentums das Wort geredet hat.
Notenverlage sollen es also — anders als Zeitungsverlage — hinnehmen müssen, dass ihre teuer hergestellten Werke uneingeschränkt und ohne jede Entlohnung vervielfältigt werden?
Es lohnt sich, einen Blick in die Kampfschriften der VG Musikedition zu werfen. Unter der Überschrift „Täter im Frack“ schreibt der Rechtsanwalt Thomas Tietze für die Verwertungsgesellschaft:
Man muss sich (…) vor Augen halten, dass das unerlaubte Kopieren nichts anderes ist als Diebstahl. Immerhin hat der Urheber eine Arbeitsleistung erbracht und damit so genanntes geistiges Eigentum geschaffen. Dieses geistige Eigentum kann genauso wie das materielle Eigentum – ein Auto beispielsweise – gestohlen, der Urheber und die sonstigen Rechtsinhaber (Verlage) so um ihren gesetzlich zugesicherten Lohn gebracht werden. Und dieser Lohn ist die notwendige Grundlage für weitere Arbeit, also die Kompositionen und deren Publikation. Der gesamte Kreislauf des Musiklebens wird gestört (…). Mit dem illegalen Kopieren wird dem gesamten Musikleben nachhaltig geschadet.
Die VG Musikedition fügt dem Text ein großes Stopp-Schild hinzu und erklärt:
Noten-Piraterie ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.
Die Argumentation mit dem „geistigem Eigentum“, um das Urheber und Verlage gebracht werden, so dass sie nicht mehr in Lage sind, neue Inhalte herzustellen — das ist die Argumentation der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in ihrem Kampf für ein eigenes Leistungsschutzrecht. Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied: das Kopierverbot für Noten besteht bereits; Gema und VG Musikedition nutzen es nur aus. Die Verlage wollen ein neues Gesetz, das bisher zulässige, kostenlose Nutzungsformen ihrer Inhalte drastisch einschränkt.
Das ist der zweite Grund, weshalb Journalisten nicht auf die Heuchelei der Politiker aufmerksam machen können: Sie sind selbst zu sehr mit Heucheln beschäftigt.
Wenn es um die eigenen Produkte geht, ist der schärfste Schutz gerade gut genug. Wenn es um die Werke anderer geht, handelt es sich bei solchem Schutz plötzlich um „Behörden-Irrsinn“, „Bürokratie-Wahnsinn“ und eine Bedrohung deutschen Kulturgutes. Journalismus kann nur dann entstehen, wenn die Werke nicht kostenlos verbreitet werden, eine Gesangskultur aber nur dann, wenn die Werke kostenlos verbreitet werden?
Nach den Maßstäben der Verleger fordern die Journalisten, die sich über Gema und VG Musikedition empören, nichts weniger als die Etablierung einer Gratiskultur und die Vorschulen als rechtsfreien Raum.
(Die „Rhein-Zeitung“ immerhin hat eine konsequente, in sich stimmige Haltung und kommentiert: „Das Urheberrecht gilt natürlich auch im Kindergarten“.)
Natürlich ist es nicht abwegig, dass Komponisten, Texter und Verlage für ihre Arbeit eine Vergütung erwarten. Das geltende Recht ist allerdings extrem: Schon wer zum Beispiel in einer Musikschule eine Seite aus einem Notenbuch kopiert, um sie nicht während des Spieles umblättern zu müssen, braucht dafür rechtlich gesehen eine kostenpflichtige Lizenz von der VG Musikedition.
Eigentlich ist die Gesetzeslage bei Musiknoten ein gutes abschreckendes Beispiel, wohin ein Recht, das sich radikal einseitig nur an den Interessen der Urheber orientiert und keinen Ausgleich mit denen der Allgemeinheit sucht, führen kann. Und sowas wollen wir für die Inhalte der Zeitungs- und Zeitungsverlage auch?

 Der Film beginnt damit, dass die Moderatorin vor dem Schiff versucht, mit Lippenstift einen roten Kussmund zu malen, wie ihn die Schiffe der Reederei tragen. Es gibt sogar einen ausführlichen Besuch bei Feliks Büttner, dem Künstler, der dieses Markenzeichen erfunden hat und nun immer neuen Tand für die Kreuzfahrtpassagiere entwerfen darf.
Der Film beginnt damit, dass die Moderatorin vor dem Schiff versucht, mit Lippenstift einen roten Kussmund zu malen, wie ihn die Schiffe der Reederei tragen. Es gibt sogar einen ausführlichen Besuch bei Feliks Büttner, dem Künstler, der dieses Markenzeichen erfunden hat und nun immer neuen Tand für die Kreuzfahrtpassagiere entwerfen darf.


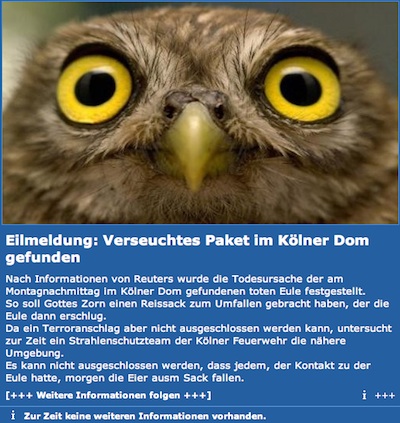




 Sie ist die Frau, die gerufen wird, wenn Super-Nanny und Peter Zwegat nicht mehr weiter wissen. Wenn es nicht damit getan ist, den Ruin abzuwenden, die Ehe zu retten oder die Kinder von der Straße zu holen, sondern es darum geht, den Ruin abzuwenden, die Ehe zu retten, die Kinder von der Straße zu holen und endlich mal ein Ordnungssystem in den Küchenschrank zu bringen. Wenn sie zu einem Notfall eilt, lässt sie sich zuerst das Innere des Kühlschranks zeigen. Sie ist „Deutschlands bekannteste Hauswirtschaftsmeisterin“.
Sie ist die Frau, die gerufen wird, wenn Super-Nanny und Peter Zwegat nicht mehr weiter wissen. Wenn es nicht damit getan ist, den Ruin abzuwenden, die Ehe zu retten oder die Kinder von der Straße zu holen, sondern es darum geht, den Ruin abzuwenden, die Ehe zu retten, die Kinder von der Straße zu holen und endlich mal ein Ordnungssystem in den Küchenschrank zu bringen. Wenn sie zu einem Notfall eilt, lässt sie sich zuerst das Innere des Kühlschranks zeigen. Sie ist „Deutschlands bekannteste Hauswirtschaftsmeisterin“. Es ist nicht ganz leicht, Yvonne Willicks und ihre Sendung „Der große Haushaltscheck“ im WDR-Fernsehen (montags, 20.15) von einer Parodie zu unterscheiden. Im Vorspann läuft sie mit in Zeitlupe wippenden Haaren energischen Schrittes auf die Kamera zu und wirkt dabei so natürlich wie Betongras. Ihre Stärke ist, dass sie weiß, dass Kartoffelbrei nur mit einer Kartoffelpresse so richtig fluffig wird, was sie gleich mal den beiden verzweifelten jungen Leuten zeigt, die Schulden haben und ein krankes Kind und dachten, man könne einfach einen Kartoffelstampfer nehmen.
Es ist nicht ganz leicht, Yvonne Willicks und ihre Sendung „Der große Haushaltscheck“ im WDR-Fernsehen (montags, 20.15) von einer Parodie zu unterscheiden. Im Vorspann läuft sie mit in Zeitlupe wippenden Haaren energischen Schrittes auf die Kamera zu und wirkt dabei so natürlich wie Betongras. Ihre Stärke ist, dass sie weiß, dass Kartoffelbrei nur mit einer Kartoffelpresse so richtig fluffig wird, was sie gleich mal den beiden verzweifelten jungen Leuten zeigt, die Schulden haben und ein krankes Kind und dachten, man könne einfach einen Kartoffelstampfer nehmen. Mit einem jungen Paar, das sich gefährlich ungesund ernährt, besucht sie ein Bergwerk und zeigt ihnen tief im Stollen dort zwei Poster von sich als aufgequollene, kranke Alte. „Genau so brauche ich die“, kommentiert sie das Entsetzen. (In die Grube mussten sie fahren, damit der Sprecher zu den Bildern sagen konnte: „Sie sehen kein Licht mehr am Ende des Tunnels.“) Ein älteres Paar setzt die Hauswirtschafts- und Selbstüberschätzungsmeisterin in ein Ruderboot. Der dramatische Effekt, wenn die Ehefrau klagt: „Ich wünsche mir, dass du ernst nimmst, wenn ich Sorgen und Kummer hab“, verliert allerdings ein bisschen dadurch, dass das rostige Ruder dabei fortwährend ironisch quietscht. Willicks fährt schließlich selbst im Tretboot zu ihnen raus und erklärt, dass sie zusammen rudern sollen.
Mit einem jungen Paar, das sich gefährlich ungesund ernährt, besucht sie ein Bergwerk und zeigt ihnen tief im Stollen dort zwei Poster von sich als aufgequollene, kranke Alte. „Genau so brauche ich die“, kommentiert sie das Entsetzen. (In die Grube mussten sie fahren, damit der Sprecher zu den Bildern sagen konnte: „Sie sehen kein Licht mehr am Ende des Tunnels.“) Ein älteres Paar setzt die Hauswirtschafts- und Selbstüberschätzungsmeisterin in ein Ruderboot. Der dramatische Effekt, wenn die Ehefrau klagt: „Ich wünsche mir, dass du ernst nimmst, wenn ich Sorgen und Kummer hab“, verliert allerdings ein bisschen dadurch, dass das rostige Ruder dabei fortwährend ironisch quietscht. Willicks fährt schließlich selbst im Tretboot zu ihnen raus und erklärt, dass sie zusammen rudern sollen.  Am Ende kommt es trotzdem zur Trennung, aber nur von Lebensmitteln und Putzutensilien im Keller.
Am Ende kommt es trotzdem zur Trennung, aber nur von Lebensmitteln und Putzutensilien im Keller.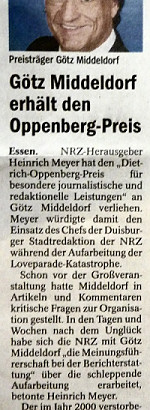 Insoweit diese Zeilen als Kritik an der Berichterstattung der Zeitung und dem peinlichen und irreführenden Selbstlob ihres Duisburger Lokalchefs verstanden werden konnten, muss ich das revidieren. In Wahrheit hat Middeldorf besondere journalistische und redaktionelle Leistungen erbracht, schon vor der Love Parade kritische Fragen gestellt und danach die Meinungsführerschaft bei der Berichterstattung erobert.
Insoweit diese Zeilen als Kritik an der Berichterstattung der Zeitung und dem peinlichen und irreführenden Selbstlob ihres Duisburger Lokalchefs verstanden werden konnten, muss ich das revidieren. In Wahrheit hat Middeldorf besondere journalistische und redaktionelle Leistungen erbracht, schon vor der Love Parade kritische Fragen gestellt und danach die Meinungsführerschaft bei der Berichterstattung erobert.