Irgendwann, spätestens nach dem Grand-Prix-Erfolg in diesem Jahr, ist aus Stefan Raab, dem Schmuddelkind, in den Medien Stefan Raab, der geniale Entertainer geworden. Der Pro-Sieben-Moderator wird mit Lob und Preis überschüttet, und da ist es ein normaler und gesunder journalistischer Reflex, wenn eine Zeitschrift beschließt, gegen den Gleichklang anzuschreiben. 

Aus jedem Absatz des Artikels, den der „Focus“ vor drei Wochen veröffentlichte, spricht der Wille, etwas Negatives über Stefan Raab zu schreiben und die Naivität und Dummheit all der Stefan-Raab-Gutfinder zu entlarven. Der Mann ist offenbar gefährlich, denn er verflucht im eigentlichen Sinne des Wortes sein Publikum. Von der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises berichten die „Focus“-Autoren:
„Ihr kommt alle in die Hölle“, sagt Raab in seiner Dankesrede (…).
Wer weiß, wie sehr er im katholischen Glauben erzogen ist und wie tief diese Wurzel seines Lebens bis heute greift, hält diese Bemerkung für allenfalls halb komisch.
Raab sagt den Fernsehschaffenden halbernst voraus, dass ihnen die ewige Verdammnis droht? Das ist tatsächlich, was ja nicht das Schlechteste ist, das man über einen Artikel sagen kann: originell.
Es ist eigentlich ziemlich leicht, Stefan Raab blöd zu finden, aber im „Focus“ liest es sich sehr angestrengt. Sein Lachen nennen die Autoren „jene praktizierte Satire am eigenen Körper“. Die Produktionsfirma Brainpool nennen sie „diese Gehirn-Badeanstalt, in der Stefan Raab als Anteilseigner und Kreativer der ganz große Bademeister ist“. Den Moderator nennen sie immer wieder „Metzgerssohn“ und schöpfen daraus die Pointen wie die, er betreibe „Humor wie eine Fleischerei“ („Grundsatz: Es darf immer noch ein bisschen mehr sein“) und sei „unersättlich“.
Fassungslos schildern sie detailliert, wie sich Lena, die ihm den Fernsehpreis überreichte, dabei vor ihm niedergekniet hat – was offenbar nicht als Scherz oder Geschenk für die Fotografen zu deuten ist, sondern als „vollkommene Demutsgeste“, die vom Publikum dann auch noch durch stehenden Applaus „zur Unterwerfung vollendet“ worden sei.
Der „Focus“ weist auf die Brüche in Raabs Leben und Karriere hin; darauf zum Beispiel, dass er Dieter Bohlen übel nehme, private Fotos von sich an die „Bild“-Zeitung zu schicken, obwohl er selbst doch vor sieben Jahren noch eine Kolumne für das Blatt geschrieben habe. Ja, der Vergleich ist schief, aber das hat er mit ungefähr allen Vergleichen in dieser Geschichte gemein. Es sei bei Raab schwer, „die Grenze zu ziehen zwischen dem Gebrauch und dem Missbrauch des Privaten“, stellen die „Focus“-Leute fest und machen dann folgenden Widerspruch auf:
Einerseits ist er der Mann, der alles riskiert für die Quote. Der sich von der Box-Weltmeisterin Regina Halmich für eine gute Show das Nasenbein einschlagen lässt. (…)
Andererseits ist Stefan Raab der Mann, der Europas Fernsehen verändern wird.
Kann mir jemand erklären, inwieweit das etwas über ein gespaltenes Verhältnis zur Privatheit aussagt oder überhaupt ein Widerspruch ist?
Der „Focus“ stellt fest, dass Details über Raabs Privatleben „privat“ seien und „niemand wissen muss“, um dann in großer Akribie Details über Raabs Privatleben zusammenzutragen. So richtig aufregende Sachen haben die drei Redakteure nicht herausgefunden, aber wie zum Ausgleich dafür dokumentieren sie auch noch das unaufregendste Detail. Wir erfahren, aus das Garagentor am Haus seiner Eltern aus „schwerem Holz“ sei und sich „per Elektromotor und Fernbedienung öffnen“ lasse. Dass der Belag in der Straße, in der er wohne, „extraglatt“ sei. Dass er im Abi-Heft 1986 keine Berufsziele angegeben habe.
Dann doch eine erhellende Enthüllung: Schon als Kind soll sich Raab in der Schule über einen kleingewachsenen Lehrer lustig gemacht haben!
Keine Frage: Es gibt einen großen Widerspruch in der Person Stefan Raabs, sogar in der öffentlichen Person. Er ist heute zu einem Symbol für Qualitätsunterhaltung geworden und sogar für einen menschenwürdigen Umgang mit Kandidaten im Fernsehen, obwohl seine Karriere nicht zuletzt auf der Bloßstellung von Nichtprominenten beruht. Der Widerspruch lässt sich teilweise dadurch erklären, dass Raab sich verändert hat — auch die Beispiele, die der „Focus“ nennt (Lisa Loch, Bimmel-Bingo, die Frau vom Maschendrahtzaun) sind Jahre alt. Doch auch wenn Raabs Grenzen heute vielleicht woanders liegen — Schadenfreude und pubertärer Humor machen immer noch einen großen Anteil seines Schaffens aus.
Doch das war dem „Focus“ in seinem unter dem Chefredakteur Wolfram Weimer neu erweckten Drang, wichtig und anders zu sein, offenbar nicht brisant genug. Und gerade die Tatsache, dass Raab sein Privatleben äußerst konsequent vor den Blicken der Öffentlichkeit schützt, nahmen die Autoren als Ansporn, möglichst tief darin zu wühlen. Und prahlen damit, wie mutig und revolutionär das ist:
Wer über den Mann spricht, der auf dem Bildschirm so konsequent das Bild vollendeter Öffentlichkeit vermittelt, riskiert Strafe.
Die Gefahr ist glaubhaft.
Schon am ersten Tag der FOCUS-Recherche trifft die Drohung ein, Stefan Raab werde von dieser Minute an nie wieder für ein Interview zur Verfügung stehen.
Nun mag es legitim sein, im privaten Umfeld von Raab zu recherchieren. Es ist aber auch für jemanden wie Raab, der sein Privatleben nie in die Öffentlichkeit getragen hat, legitim, aus dieser Recherche die Konsequenz zu ziehen und jede Mitarbeit an dem Werk abzulehnen …
… und hinterher jedes Wort auf die Waage zu legen (machen Sie sich Ihr eigenes „Focus“-artiges Wortspiel hier bitte selbst). Zwanzig Punkte umfasst die Gegendarstellung von Raab, die der „Focus“ heute veröffentlicht. Die Illustrierte drucke sie „sehr gern“, schreibt sie dazu, „mit Blick auf den Informationsgehalt“. Raab hatte offensichtlich Spaß daran, nicht nur gravierende Fehler, sondern auch die kleinsten Details zu korrigieren:
6. Weiter heißt es: „Der Metzgerssohn, der heute noch das Mettbrötchen mit Zwiebeln, Gurkenscheibe dazu, ganz hinten in seiner Stammkneipe schätzt (…).“
Hierzu stelle ich fest, dass ich nie Mettbrötchen mit Gurkenscheiben dazu esse und auch keine Stammkneipe habe. (…)
20. In der Bildunterzeile des Fotos auf S. 166, das ein Mettbrötchen zeigt, heißt es: „Sein Brötchen – in der Kölschkneipe“.
Hierzu stelle ich fest, dass es sich nicht um mein Mettbrötchen handelt.

Der „Focus“ empfiehlt unter anderem diese Punkte seinen Lesern, „die sich ein eigenes Bild [mutmaßlich über den Wahrheitsgehalt der Gegendarstellung] machen möchten“. Wie heuchlerisch.
Natürlich ist es lächerlich, ein solches Quatschdetail zu korrigieren. Aber noch lächerlicher ist es doch, ein solches Quatschdetail überhaupt erst für berichtenswert zu halten. Und am allerlächerlichsten, das erste für lächerlich zu halten und das zweite nicht und sich über den mangelnden „Informationsgehalt“ der Gegendarstellung lustig zu machen.
„Den Wahrheitsgehalt der Gegendarstellung wollen wir nicht kommentieren“, schreibt „Focus“. Schade, denn bei einigen durchaus relevanten Punkten liegt die Illustrierte falsch. Zum Beispiel, wenn sie den Eindruck erweckt, Raab verdiene auch noch an Oliver Pocher und Mario Barth mit – die beide längst bei anderen Unternehmen unter Vertrag sind. Auch von regelmäßigen Strafen, die Pro Sieben laut „Focus“ für Schleichwerbung in Raab-Sendungen zahlen musste, ist nichts bekannt.
„Focus“ hat die Gegendarstellung einfach gedruckt, nachdem das Magazin von Raabs Anwalt dazu aufgefordert wurde — die Redaktion verzichtete auf die übliche juristische Gegenwehr. Natürlich ist es einerseits ganz schön, dass es, wie es aussieht, keine juristische Auseinandersetzung um den Artikel geben wird, bei der dann womöglich auch Fragen zu klären wären wie die, ob Raabs Haus von einer Hecke oder von Bäumen umgeben ist und womöglich der Gärtner als Zeuge geladen würde. Andererseits ist es auch sensationell billig, sich als Medium einfach achselzuckend hinzustellen und zu suggerieren, dass es ja auch nicht darauf ankommt, was nun die Wahrheit ist.
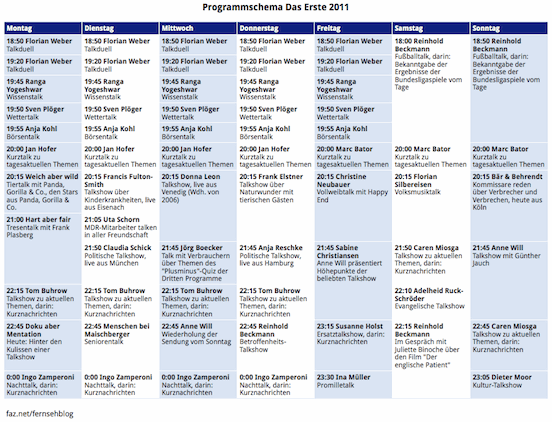
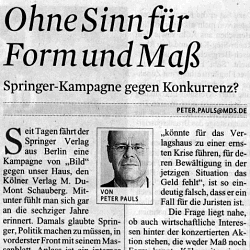 Es ist ein groteskes Zerrbild, das Chefredakteur Peter Pauls am vergangenen Samstag in seinem Kommentar im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zeichnet. Einerseits spielt er die spektakuläre Auseinandersetzung zwischen Konstantin Neven DuMont und seinem Vater zu einem „internen Vorgang“ herunter. „Solche Umstände“, wie Pauls sie mit erkennbarem Willen zur Verschleierung nennt, gebe es „täglich in Wirtschaftsbetrieben“. Es handele sich um eine „interne Personalie“. Andererseits tut er so, als würde ausschließlich die Axel-Springer-AG über die Vorgänge im Haus berichten, und vergleicht deren aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge im Unternehmen allen Ernstes mit der Hetze von „Bild“ auf die Studenten Ende der sechziger Jahre. „Ununterbrochen und in kampagnenhaft anmutender Weise“ berichte das Blatt und blase die Sache zur „Staatsaffäre“ auf.
Es ist ein groteskes Zerrbild, das Chefredakteur Peter Pauls am vergangenen Samstag in seinem Kommentar im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zeichnet. Einerseits spielt er die spektakuläre Auseinandersetzung zwischen Konstantin Neven DuMont und seinem Vater zu einem „internen Vorgang“ herunter. „Solche Umstände“, wie Pauls sie mit erkennbarem Willen zur Verschleierung nennt, gebe es „täglich in Wirtschaftsbetrieben“. Es handele sich um eine „interne Personalie“. Andererseits tut er so, als würde ausschließlich die Axel-Springer-AG über die Vorgänge im Haus berichten, und vergleicht deren aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge im Unternehmen allen Ernstes mit der Hetze von „Bild“ auf die Studenten Ende der sechziger Jahre. „Ununterbrochen und in kampagnenhaft anmutender Weise“ berichte das Blatt und blase die Sache zur „Staatsaffäre“ auf. Er müsste sich dazu natürlich erst gegen Berndt Thiel durchsetzen, der in einer konzertierten Aktion (lustigerweise exakt das, was Pauls Springer vorwirft) am selben Tag im „Express“ einen Kommentar mit teils wortgleichen Formulierungen veröffentlicht hat. Sein Artikel beginnt mit den Worten: „Ein Vater, ein Sohn, ein Unternehmen, unterschiedliche Ansichten — ein Stoff für Schlagzeilen? Ein Stoff für Häme?“ Das fragt der stellvertretende Chefredakteur eines Blattes, das dieselben Fragen bei ungleich nichtigeren Anlässen entschieden mit „Ja“ beantwortet. Man muss ihn fast bewundern dafür, dass er sich diese Fassungslosigkeit abringen konnte.
Er müsste sich dazu natürlich erst gegen Berndt Thiel durchsetzen, der in einer konzertierten Aktion (lustigerweise exakt das, was Pauls Springer vorwirft) am selben Tag im „Express“ einen Kommentar mit teils wortgleichen Formulierungen veröffentlicht hat. Sein Artikel beginnt mit den Worten: „Ein Vater, ein Sohn, ein Unternehmen, unterschiedliche Ansichten — ein Stoff für Schlagzeilen? Ein Stoff für Häme?“ Das fragt der stellvertretende Chefredakteur eines Blattes, das dieselben Fragen bei ungleich nichtigeren Anlässen entschieden mit „Ja“ beantwortet. Man muss ihn fast bewundern dafür, dass er sich diese Fassungslosigkeit abringen konnte.








