Irgendjemand in der Fotoredaktion von „Welt kompakt“ hat einen sehr, sehr guten Humor.

Irgendjemand in der Fotoredaktion von „Welt kompakt“ hat einen sehr, sehr guten Humor.

Dirk Kurbjuweit, der Leiter des Hauptstadtbüros des „Spiegels“, wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, dass sie sich bei ihrer Politik in extremem Maß von Stimmungen in der Bevölkerung leiten lässt. Dabei wäre es seiner Meinung nach für Politiker möglich, die ununterbrochen veröffentlichten Umfragen einfach zu ignorieren. Die spiegelten ohnehin nicht wirklich den Volkswillen, weil die Leute oft lögen oder Tagesstimmungen folgten. Er erwarte von Politikern, dass sie zwischen den Wahlen, unbeeindruckt von Stimmungen, das tun, was sie für richtig halten. Wegen der ganzen Umfragen würden die Poliker stattdessen zaudern.
Johann Schilling und Julia Schwarz, die Kurbjuweit interviewt haben ((für das Buch „Die Casting-Gesellschaft“, das in diesem Monat erscheint)), wiesen den Journalisten an dieser Stelle des Gesprächs auf ein kleines Detail hin:
Der Spiegel macht aber auch selbst Umfragen, mit der Popularitätstreppe sogar eine besonders oberflächliche, die Politiker nach ihrer Beliebtheit bewertet.
Das sind nicht meine Lieblingsseiten im Spiegel.
Aber Sie sind Leiter des Hauptstadtbüros.
Und dafür nicht zuständig.
Wenn es nach Ihnen ginge, würden Sie diese Seiten also abschaffen?
Nein, denn ich finde nicht die Umfragen schlecht, sondern die Politiker feige, die sich danach richten. Auf die Popularitätstreppe schauen viele Menschen, um sich zu informieren, wer ist gerade in, wer ist out. Aber von den Politikern erwarte ich die Souveränität zu sagen: „Das ist mir jetzt egal, ich mache es trotzdem so weiter.“
Kurbjuweits Antwort ist bemerkenswert. Nicht nur, weil sie so windelweich ist, dass jeder „Spiegel“-Journalist sie jedem Politiker um die Ohren gehauen hätte. Sondern vor allem, weil sie einen typischen Journalistendefekt zeigt: Wir leugnen, dass unsere Arbeit Folgen hat. Wir tun so, als wäre das, über das wir berichten, unbeeinflusst davon, dass wir darüber berichten. Und wir lehnen eine Verantwortung für die Folgen unserer Berichterstattung ab.
Kurbjuweit sagt, dass Umfragen die Politik schlechter machen. Aber Schuld daran seien nur die Politiker, die auf sie hören. Nicht die Medien, die sie in Auftrag geben und durch ihre Berichterstattung darüber es Politikern fast unmöglich machen, nicht auf sie zu hören.
Kurbjuweit sagt: „Eine Umfrage ist keine Wahl. Man kann sie getrost ignorieren.“ Das „man“ im zweiten Satz bezieht sich aber offenbar ausschließlich auf die Politik, nicht auf die Medien. Dabei sind sie es — und weit vorne natürlich das dauerhyperventilierende Leitmedium „Spiegel Online“ –, die sich auf jedes vorübergehende Ausreißerergebnis stürzen und es zur Nachricht machen, Konsequenzen daraus fordern oder ihr Ausbleiben skandalisieren, und mit Formulierungen wie „Schwarz-gelb verliert Mehrheit“ Umfragen als Wahlergebnisse behandeln.
Diese Umfragen und die Art der Berichterstattung verändern Politik. Es hat Folgen, dass die Medien Popularitätswettbewerbe für wichtig halten und dass zum Beispiel Karl-Theodor zu Guttenberg — offenbar losgelöst von irgendeinem fundierten Urteil über seine Amtsführung als Verteidigungsminister — in diesen Popularitätswettbewerben weit vorne liegt. Es beeinflusst seine Wahrnehmung, seine Möglichkeiten, und es beeinflusst natürlich auch zukünftige Meinungsumfragen.
Ich nehme nicht an, dass Dirk Kurbjuweit unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet oder seine Artikel für wirkungslos hält. Gerade der überaus selbstbewusst auftretende Journalismus macht sich an entscheidender Stelle unsichtbar, lehnt Verantwortung für die Folgen von Berichterstattung ab und tut so, als sei man nur ein nicht-teilnehmender Beobachter.
Manchmal ist die Lächerlichkeit dieser Illusion offenkundig (das heißt: für jeden Beobachter offenkundig; für die verantwortlichen Journalisten anscheinend nicht). Das prominenteste Beispiel der jüngsten Zeit ist sicher die Doppelrolle des „Spiegel“, sich Thilo Sarrazin als redaktionelle Werbeplattform zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig (oder genauer: ein bis zwei Wochen später) seine Fehler und die negativen Folgen der Veröffentlichung zu kritisieren.
So ein Spagat gelingt nicht ohne Schmerzen, und in diesem Fall tat schon die Titel-Schlagzeile weh: „Warum so viele Deutsche einem Provokateur verfallen.“ Menschen „verfallen“ eigentlich keinem „Provokateur“. Sie verfallen einem Demagogen oder Rattenfänger. Das sind aber Begriffe, die der „Spiegel“ schon deshalb nicht benutzen konnte, weil er damit gesagt hätte, einem solchen willenlos eine publizistische Plattform geboten zu haben.
Der „Spiegel“ selbst ist dem Mann natürlich nicht „verfallen“, dazu sind „Spiegel“-Redakteure viel zu klug. Sie haben dem Mann ja nur eine Woche lang eine Bühne geboten, unwidersprochen seine Thesen auszubreiten. Deshalb nennt das Magazin Sarrazin auch nur „Volksheld“ und nicht „‚Spiegel‘-Held“, was mindestens so treffend gewesen wäre. Nein, die Rolle des „Spiegels“ selbst in der Sarrazin-Affaire kam im „Spiegel“ der vergangenen Woche nicht vor. Man selbst ist, wie üblich, als Akteur unsichtbar. Irgendwie, auf obskuren Wegen, scheinen Sarrazins Thesen an die breite Öffentlichkeit geraten zu sein, man weiß es nicht genau. Und die hätte sie ja nicht wichtig nehmen müssen, ähnlich wie die Politiker die Umfragen.
Ich bin überzeugt, dass dieses journalistische Selbstverständnis keine Zukunft hat. Dass auch ein Medium wie der „Spiegel“ irgendwann anfangen muss, seine Leser ernst zu nehmen, und das heißt: mit ihnen zu kommunizieren, Abwägungen, die zu redaktionellen Entscheidungen geführt haben, transparent zu machen, Widersprüche offenzulegen, nicht mehr so zu tun, als wäre man kein politischer Akteur, endlich anzufangen, die eigene Rolle und Verantwortung öffentlich zu reflektieren.
Aber der „Spiegel“ ist mit seiner Heuchelei nur ein besonders krasser Fall. Medien verschweigen systematisch ihre eigene Rolle beim Herstellen der Nachrichten, über die sie dann berichten. Angeblich ist die Aufregung um Sarrazins die größte jemals um so ein Buch. Ich würde das grundsätzlich bezweifeln, aber selbst wenn: Zu welchem Teil liegt das an der Reaktion in der Bevölkerung? Und zu welchem an der Erregung der Medien? Schreiben die Medien so viel, weil das Volk so stark reagiert, oder umgekehrt? Ich weiß die Antwort nicht, aber müsste nicht gerade das Bewusstsein um die eigene Möglichkeit, solche Debatten groß zu machen, die Medien vor solchen Superlativen zurückschrecken lassen?
Das ZDF ermittelte in seinem aktuellen „Politbarometer“, dass 57 Prozent der Befragten meinen, das Zusammenleben von Deutschen und Zuwanderern funktioniere nicht gut. Ich selbst hätte (trotz oder wegen Berlin-Kreuzberg als Arbeitsort) Schwierigkeiten, eine Antwort auf eine solch pauschale Frage geben, und ich bezweifle, dass viele andere Menschen eine gute Grundlage haben, sie zu beantworten. Das Ergebnis ist sicher nachhaltig geprägt durch die Sarrazin-Diskussion der vergangenen Wochen. Immer wieder hieß es, dass man über die Form und die rassistischen Argumentationsmuster streiten könne. Aber dass die Integrationspolitik in Deutschland gescheitert sei, das sei natürlich eine Tatsache. Heribert Prantl war einer von wenigen, die diesen Befund, der irgendwie gegeben schien, in Frage stellten.
Die Art, wie über Integration in Deutschland in den Medien berichtet wurde, hat den Eindruck geweckt oder bestärkt, dass es große Probleme gibt — und das weitgehend ohne dass dafür Fakten vorgelegt werden mussten. Dass die deutschen Medien von dpa bis „Spiegel Online“ in erschreckender Breite und bis heute unkorrigiert die Falschmeldung verbreiten, eine Sarrazin-Partei käme auf 18 Prozent der Stimmen, tut ein übriges: Ich vermute, dass angesichts solcher Zahlen noch mehr Menschen eine solche obskure fiktive Partei für wählbar halten.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht nicht darum, nicht mehr zu berichten. Es geht darum, sich bewusst zu werden, dass das, was Journalisten zu Nachrichten machen, Folgen hat, und dass das, was Journalisten zu Nachrichten machen, oft die Folge von Berichterstattung ist. Medien sind nicht nur Chronisten, die festhalten, was passiert, ohne es zu beeinflussen. Ihre Entscheidungen, was sie zur Nachricht machen und wie, haben Konsequenzen.
Das ist so banal und scheint doch im Alltag so oft keine Rolle zu spielen. Ein harmloses Beispiel dafür sind die „Spiegel Online“-Artikel, die irgendwelchen unbekannten „Prominenten“ Aufmerksamkeit verschaffen, indem sie sich darüber lustig machen, wie irgendwelche unbekannten „Prominenten“ um Aufmerksamkeit kämpfen. Ein klassisches Beispiel sind die Berichte über Amokläufe und Suizide, bei denen viele Medien in Kauf nehmen, dass sie die Zahl der Amokläufe und Suizide erhöhen.
Und dann ist da auch der Fall des amerikanischen Pfarrers Terry Jones mit seiner Ankündigung, am 11. September 200 Ausgaben des Koran vor dem Gemeindehaus in Gainesville, Florida, verbrennen zu wollen, was prompt von islamischen Fanatikern zum Anlass für blutige Ausschreitungen genommen wurde. Mal abgesehen davon, dass eine solche Reaktion durch nichts zu rechtfertigen ist: Ist der Auslöser dafür die Ankündigung des Pastors? Oder die Berichterstattung darüber durch die Medien?
Anders gefragt: Warum ist die Provokation irgendeines obskuren amerikanischen Extremisten eine weltweite Nachricht? Die Antwort ist so einfach wie paradox: Weil sie, wenn sie weltweit verbreitet wird, das Potential hat, blutige Ausschreitungen von islamischen Extremisten auszulösen. Die Meldung fungiert als self-fulfilling prophecy. Und auch wenn es den bekloppten Pfarrer in den USA sowie die menschenverachtenden Islamisten in Afghanistan in keiner Weise aus ihrer Verantwortung nimmt, sind die Medien in diesem gefährlichen Spiel mindestens ein Katalysator.
Bevor jetzt alle „Selbstzensur!“ rufen und meinen, dass man damit vor den Gegnern von Meinungs- und Bücherverbrennungsfreiheit kapituliere: Journalisten treffen jeden Tag die Entscheidung, welche Dinge, die auf der Welt passieren, sie zu Nachrichten machen und welche nicht. Das ist ein entscheidender Teil ihres Berufs. Es gibt wenige Argumente dafür, Terry Jones jenseits der Lokalberichterstattung in seinem Ort zur Kenntnis zu nehmen und ihm den Gefallen zu tun, die anmaßende Ankündigung vom „International Burn A Koran Day“ auf dieser Weise fast noch wahr klingen zu lassen.
Terry Jones war eine weltweite Nachricht, weil er in knappster Form die zunehmende Feindschaft vieler Amerikaner zum Islam symbolisierte. Aber er war es auch wegen des Nervenkitzels, dass die Berichterstattung dramatische Folgen haben könnte. Und aus dem schlichten Grund, dass andere Medien darüber berichtet haben. Journalisten halten für eine Nachricht, was andere Journalisten für eine Nachricht halten.
Natürlich ist es, wie Medienblogger Roy Greenslade beim „Guardian“ dokumentiert, ein komplexes Zusammenspiel, in dem auch Politiker und das Internet Rollen haben. Aber wir sollten nicht so tun, als sei die Unterscheidung, was eine Nachricht ist und was nicht, ein objektives, einer Sache schon innewohnendes Kriterium und nicht eine Folge von subjektiven Entscheidungen.
Dies ist kein Plädoyer für irgendeine Form von Selbstzensur. Dies ist ein Plädoyer dafür, sich der Folgen einer Berichterstattung bewusst zu werden und die eigene Rolle zu thematisieren.
Übrigens: 2008 hat ein Pastor der durch ihren Slogan „God Hates Fags“ und ihre Demonstrationen bei Beerdigungen von Soldaten und schwulen Gewaltopfern berüchtitgten Westboro Baptist Church, an einer Straßenecke einen Koran angezündet und das gefilmt. Es hat damals kaum jemand darüber berichtet. Es war keine Nachricht. War das falsch?
Geld verdienen mit Qualitätsjournalismus im Internet? Nichts leichter als das. Das „Reporter-Forum“ bietet 3000 Euro für eine einzige Reportage. Sie muss nur herausragend sein.
Das habe ich vergangenes Jahr schon geschrieben, als der „Reporterpreis“ zum ersten Mal verliehen wurde. (Nur dass es damals noch 5000 Euro waren, aber diesmal gibt es insgesamt acht statt vier Kategorien, und die beste StrickWeb-Reportage ist nur eine davon.) Anscheinend ist die Zahl der Einreichungen in der Online-Kategorie bisher sehr überschaubar, was natürlich umgekehrt bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Geld und Ruhm abzustauben, besonders groß ist.
Aber noch sind zwei Wochen Zeit, gelungene Reportagen vorzuschlagen. In der Jury sitzen u.a. Katrin Passig und ich. Alle weiteren Details stehen hier.
Zum Sinn von Parteiausschlussverfahren sagt Thilo Sarrazin dies: „Jeder Verein hat ja Ziele. Wenn jemand in einem Verein Handball spielen will, und es ist ein Fußballverein, und er will den Ball immer mit der Hand anfassen, dann gehört er nicht in einen Fußballverein, dann soll er in einen Handballverein gehen.“ Was für ein schöner, treffender Vergleich. Was für ein angenehmer Kontrast zu all den Hysterikern und Demagogen, die behaupten, die Meinungsfreiheit sei bedroht, wenn Worte Konsequenzen haben, und damit in Wahrheit gegen das Recht kämpfen, Sarrazin zu widersprechen.
Als Sarrazin den Vergleich machte, hatte er gerade das erste und, wie er damals noch glaubte, einzige Ausschlussverfahren aus der SPD hinter sich. Es war Juni, und er war Gast in der Versuchssendung einer Late-Night-Show mit Benjamin von Stuckrad-Barre, die vom nächsten Jahr an auf ZDFneo laufen soll. Ein kurzer Ausschnitt, in dem beide „Wer bin ich?“ spielen und Sarrazin Stuckrad die Rolle des Joseph Goebbels zugedacht hatte („der Mann war sehr gut mit Worten, ein Menschenverführer“), war bei YouTube aufgetaucht. Das ZDF ließ ihn löschen und veröffentlichte stattdessen dankenswerterweise die ganze Sendung. Es ist ein erstaunliches Dokument – auch dafür, wie unterhaltsam und erkenntnisstiftend eine solche Show mit dem ununterbrochen zwischen sinnloser Albernheit und genialer Wachheit flackernden Stuckrad-Barre sein kann.
Die beiden Protagonisten wirken einander auf merkwürdige Weise ähnlich: ungelenk, faszinierend unberechenbar, süchtig nach Aufmerksamkeit. Stuckrad angriffslustig, hyperaktiv, der mitten im Small-Talk einfach mal die Frage verschießt: „Sind Sie ein Rassist“ (und nach dem kurzen Knalleffekt natürlich sofort wieder vergisst), Sarrazin bedächtig, vorsichtig um die aufgestellten Fallen herumtänzelnd (obwohl die größte schon die war, überhaupt in eine solche Show zu gehen). Und obwohl Stuckrad an den Inhalten am wenigsten interessiert ist, entlockt er Sarrazin kluge Sätze – wie den, auf den ironisch-naiven Vorhalt, dass er seine ausländerkritischen Thesen doch einfach auch „netter“ formulieren könnte: „Sage ich es anders, sage ich auch etwas anderes.“ Das ist auf so selbstblinde Weise hellsichtig und treffend, das es beim Angucken wehtut.
Gut, dass eh gerade keine größeren Debatten laufen, die ich medienjournalistisch in diesem Blog begleiten könnte, so kann ich in Ruhe die Gewinner meines kleinen Hauck-&-Bauer-Gewinnspiels bekanntgeben. Gesucht war ein Text zu dieser Zeichnung:
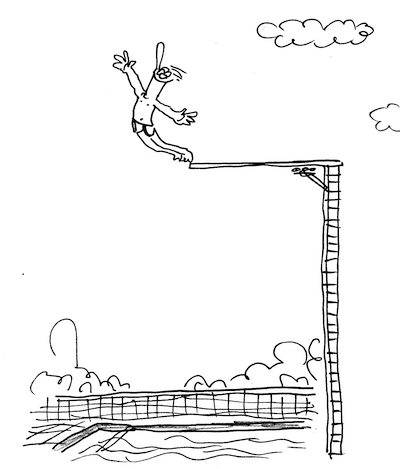
Und die Gewinnzahlen lauten: 1, 14, 46, 57 und 132. Oder konkret:
Diese fünf sind die Favoriten von Elias Hauck und Dominik Bauer. Sie gewinnen jeweils eine Ausgabe des gerade erschienenen Buches von Hauck & Bauer, „Hier entsteht für Sie eine neue Sackgasse“. (Falls es einen ersten Preis gäbe, ginge er an Timo.)
Um das schlechte Karma auszugleichen, geht ein weiteres Exemplar an den „Agnostiker“ für seinen Kommentar:
Kein Buch, aber eine lobende Erwähnung, gibt es für den Vorschlag:
Das ist einer meiner persönlichen Favoriten. Er musste leider mangels Eis im Bild disqualifiziert werden.
Die mit einer Million Euro dotierte Aufgabe, den Original-Text des Cartoons zu erraten, wurde nicht gelöst. Die richtige Antwort hätte gelautet:
Die Autoren legen Wert auf den Hinweis, dass sie das auch selbst nicht lustig finden.
Allen Teilnehmern vielen Dank fürs Mitmachen!
Auch Henryk M. Broder ist ein Opfer von Thilo Sarrazin. Seit Jahren müht er sich, Oberprovokateur der Republik zu werden, stapelt unermüdlich Polemik auf Polemik, arbeitet sich am Islam und anderen echten oder imaginären Tabus ab und wettert in den reichweitenstärksten Medien des Landes gegen den Medien-Mainstream, und dann kommt so einer daher und lässt ihn mit einem Mal wie einen Waschlappen aussehen. So bleibt ihm als Fluchtpunkt nur der Nihilismus. In den Talkshows war lange schon sichtbar, dass Broder ungleich mehr an der nächsten Pointe gelegen ist, als an einem inhaltlichen Streit. Das ist nicht die schlechteste Eigenschaft für einen Talkshowgast, aber auf Dauer in ihrer Fruchtlosigkeit oder genauer: ihrem demonstrativen Desinteresse an jeder Form möglicher Fruchtbarkeit ermüdend.
Am Donnerstag bei Maybritt Illner hatte er sich vollkommen in einen bunt schillernden Mirdochegal-Anzug aus Teflon zurückgezogen. Mit wissenschaftlichen Argumenten zum Beispiel muss man ihm gar nicht kommen, denn Broder weiß: „Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse verjähren spätestens nach fünf Jahren und werden durch gegenteilige Ergebnisse ersetzt.“ Bezieht sich jemand auf das Selbstbild Deutschlands zur Weltmeisterschaft, sagt er: „Fußball geht mir sowieso am Arsch vorbei.“ Macht ihn jemand auf einen möglichen Widerspruch zu früheren Positionen aufmerksam, erwidert er reflexartig: „Ich bin älter geworden. Vielleicht auch reifer.“
Es ist sinnlos, mit ihm zu diskutieren – es sei denn, der Sinn bestünde bloß darin, Sätze zu provozieren wie den über einen Möllemann-Vergleich: „Das ist ein Vergleich, den können sie runterfallen lassen aus 4000 Metern Höhe, ohne Fallschirm, es würde nichts passieren.“ Tatsachen, auch nur der bloße Versuch, herauszufinden, wie etwas ist – das interessiert ihn nicht. Er muss nur den Namen eines interkulturellen Projektes hören, um die Augen zu rollen: Das kann nichts sein.
Dass die Kanzlerin Sarrazins Buch als „nicht hilfreich“ bezeichnet hat, „grenzt an die übelste Tradition der Reichsschrifttumskammer“, sagt er noch. Er erntet dafür drei Sekunden Empörung, aber dann diskutieren alle wieder über Sarrazins Entgleisungen und nicht über Broders.
Fast kann er einem leidtun.
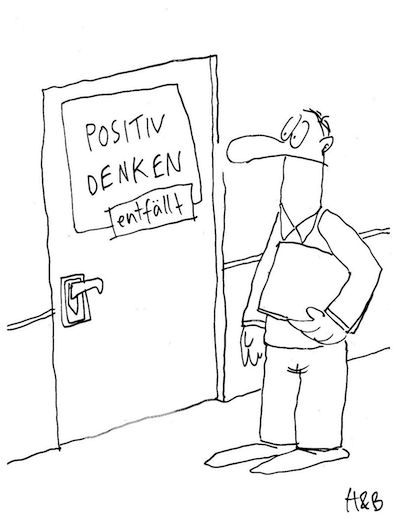
Eigentlich hätte dieser wunderbare Cartoon der Titel der neuen Sammlung von Witzbildchen von Hauck & Bauer sein sollen. Aber dann kam etwas dazwischen, und nun heißt das Buch „Hier entsteht für Sie eine neue Sackgasse“. Es ist ein Werk, das ich rundherum empfehlen kann, ich habe nämlich das Vorwort dafür geschrieben.
Es war mein erstes Gast-Vorwort, eine große Ehre und eine kleine Last, denn eigentlich weiß ich gar nicht, was die Menschen von so einem Vorwort erwarten, und zweitens soll es, wenn man die Leute und ihre Kunst schon mag (und ich mag Hauck & Bauer und vor allem ihre Strips „Am Rande der Gesellschaft“ am Rande des Gesellschaftsteils der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ sehr), ja auch gut werden und treffend. Ich habe es aber dann doch geschafft, den Abgabetermin nur um wenige Wochen zu überziehen.
Immerhin erspart mir der fertige Text jetzt die Mühe, zu versuchen, die Witzigkeit von Hauck & Bauers Cartoons zu erklären — ich verweise da einfach auf das Standardwerk zum Thema und komme gleich zur Sache.
Ich habe nämlich die Freude, fünf Exemplare von „Hier entsteht für Sie eine neue Sackgasse“ verschenken zu dürfen. Und damit das nicht nur so eine olle Verlosungsaktion wird, habe ich mir zusammen mit den jungen Herren Künstlern einen kleinen Wettbewerb ausgedacht. Es geht um folgenden, unveröffentlichten Cartoon:
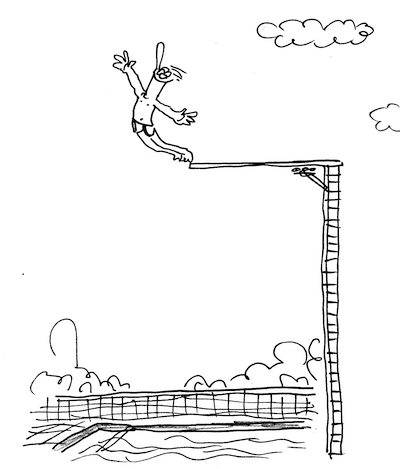
Und hier nun die beiden Gewinnmöglichkeiten:
(A) Erraten Sie den Originaltext.
(B) Denken Sie sich einen lustigen Text aus: Was denkt der Mann?
Wer die richtige Antwort bei (A) errät, gewinnt 1 Mio Euro. ((sicherheitshalber muss er außerdem im richtigen Moment die richtige Leitung getroffen haben, aber ich bin zuversichtlich, darauf nicht zurückgreifen zu müssen.))
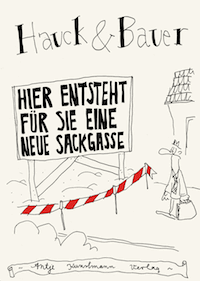 Wer zu den fünf lustigsten Einsendungen von (B) gehört, bekommt das Buch. Antworten einfach in die Kommentare oder an [email protected]. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, 3. September; die Jury besteht aus Elias Hauck, Dominik Bauer und notfalls mir.
Wer zu den fünf lustigsten Einsendungen von (B) gehört, bekommt das Buch. Antworten einfach in die Kommentare oder an [email protected]. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, 3. September; die Jury besteht aus Elias Hauck, Dominik Bauer und notfalls mir.
Alle, die nicht gewinnen, müssen sich halt das Buch kaufen. Es enthält neben ausgewählten Cartoons und Comics aus der „FAS“, der „Titanic“ und der Witzrubrik von „Spiegel Online“ auch einzelne zuvor unveröffentlichte Werke und ist ab heute im gut sortierten Fachhandel erhältlich.
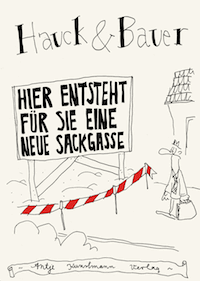 Vorwort zum Buch „Hier entsteht für Sie eine neue Sackgasse“.
Vorwort zum Buch „Hier entsteht für Sie eine neue Sackgasse“.
Ich finde die Cartoons von Hauck & Bauer total lustig.
In einer perfekten Welt würde dieser Satz reichen. Man würde ihn einfach aufs Cover schreiben, und die Leute in den Buchhandlungen würden beim Vorbeigehen stutzen und zueinander sagen: „Kuck mal, Ulla, ich weiß zwar nicht, wer dieser ‚Niggemeier‘ ist, aber der kennt sich bestimmt aus; lass uns doch ein Buch mitnehmen oder besser gleich zwei, weil Lustiges kann man ja nie genug haben“, und allen wäre gedient: mir, den amüsierbereiten Käufern, dem Verlag und nicht zuletzt den sympathischen jungen Herren namens Elias Hauck und Dominik Bauer.
Dass es keine perfekte Welt ist, merken Sie schon daran, dass dieser Text nicht auf dem Cover steht, sondern sich im Buch versteckt. Und nun weiß ich zwar weder, was das für Menschen sind, die sich in einem Buch mit Witzbildchen ausgerechnet den witz- und bildlosen Text durchlesen, noch, was sie sich davon versprechen, aber ich fürchte: jedenfalls mehr als einen Satz.
Ich habe mir deshalb Gedanken gemacht, was die Cartoons von Hauck & Bauer so lustig macht. Ich bin dafür nicht besonders prädestiniert, ich bin ja kein Experte, sondern schreibe nur zufällig eine Fernsehkolumne in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, in der am Rande des Gesellschaftsteils die wunderbare Reihe „Am Rande der Gesellschaft“ erscheint (wenn Sie die Wirtschaftsteile unauffällig entfernen, liegen sie direkt aufeinander, meine Texte und deren Cartoons). Aber ich bin Fan, und nach längerem Grübeln ist mir eine Erklärung eingefallen: Diese gezeichneten Szenen funktionieren wie Stenographie, wie eine Kurzschrift auf das Leben. Im Geist ergänzen wir die dürren Linien zu kompletten Portraits und die kargen Dialoge zu vollständigen Geschichten.
Ich weiß nicht, wie sie das machen, und ich will nicht ausschließen, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Schaf zum Beispiel, das da auf einem Hügel steht und versuchsweise „Mööh“ sagt, bis es vom Schäfer zur Ordnung gerufen wird – ich bin überzeugt davon, dass es mich im vierten Panel mit hochgezogenen Augenbrauen anguckt, wie ein Komiker, der am Ende eines Sketches stumpf in die Kamera schaut. Nun haben nicht nur Schafe keine richtigen Augenbrauen, sondern das Zeichenschaf auch nicht einmal ein Gesicht. Nur einen Kreis mit einem Blumenkohlkringel als Flauschkopf. Und trotzdem guckt es mich provozierend an.
Zwei, drei Striche auf einem Kopf identifizieren wir sofort als einen Scheitel, und den Mann, der ihn trägt, als eine typische Figur aus der Nachbarschaft. Die Leute, die die Cartoons von Hauck & Bauer bevölkern, sehen natürlich selten so aus wie wir oder unsere Freunde, sondern wie die etwas komischen Leute, die im Supermarkt vor einem stehen oder in der Bahn hinter einem sitzen. Es sind keine Karikaturen von Extremen: Der größte Teil des Personals, das in der Welt von Hauck & Bauer lebt, sind mittelalte, unauffällige, ein bisschen spießige Menschen. Aber sie haben Charakter, sie scheinen auch außerhalb der Umrandung der Zeichnung zu existieren, man kann sie wieder erkennen: Sie sind lebensecht. Das ist erstaunlich angesichts der minimalistischen, flüchtig hingeworfen wirkenden Art, in der sie gezeichnet sind. Aber die paar Striche sind alles, was wir brauchen, um die Figuren im Kopf selbst auszumalen.
Jener Mann zum Beispiel, der vor der Seminartür steht und feststellen muss, dass der Kurs „Positiv denken“ leider ausfällt. Der Witz lebt nicht zuletzt von der echten Tragik, die sich in in seinen Augen spiegelt und dadurch noch verstärkt wird, dass er ganz offenkundig seine Hausaufgaben gemacht hat: Worin auch immer sie bestanden haben mögen, er trägt sie als Stapel brav unter dem Arm. Sie sind Papier gewordenes Symbol für die Hoffnung, die sich dieser Mann gemacht hat, und für die unverschuldete Enttäuschung, die sicher Spuren hinterlassen wird. Wir wissen ungefähr nichts über diese traurige Figur, aber wir ahnen alles.
Die Cartoons sind Alltagsbeobachtungen, mal böse, mal tragikomisch. Die Geschichten, die Dominik Bauer sich ausdenkt und Elias Hauck zeichnet, schaffen das Kunststück, gleichzeitig wahr und abseitig zu sein.
Es sind Miniaturen, die die Natur des Menschen und die Komplexität der modernen Welt als Resonanzkörper…
Nein, Moment. Das ist Unsinn. Vermutlich tut man Hauck & Bauer und ihren Cartoons damit Unrecht. Auch ein Strichmännchen hat ein Recht darauf, einfach Strichmännchen zu sein und ein Witz nur ein Witz.
Denn auch und vor allem das zeichnet die Werke in diesem Buch aus: Die hemmungslose Lust am Unfug. Eine bekloppte Situation zu schaffen, einen Kalauer auszureizen, eine billige Pointe zu veredeln – herrlich albern zu sein. Sie schaffen das mit einem traumwandlerischen Gespür für das Absurde, das im Normalen steckt und nur einen winzigen Millimeter neben dem Bekannten liegt, und einer bewundernswerten Leichtigkeit.
Aber ich fürchte, ich bin damit dann doch wieder bei dem Satz: Ich finde die Cartoons von Hauck & Bauer total lustig.
Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man den Moderator einer politischen Talkshow nach Betrachten seiner Arbeit fragen möchte, ob er unser politisches System verstanden hat. Ob er weiß, dass es auf einem Wettstreit von Ideen und Personen beruht. Und es darum merkwürdig ist, einen Politiker wie Norbert Röttgen, der den CDU-Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen durch seine Kandidatur um den Parteivorsitz die Möglichkeit gibt, eine Wahl zu treffen, fast als eine Art selbstmörderischen Irren darzustellen. Die Redaktion hat sogar eine fiktive „Bild“-Schlagzeile vom Tag nach der möglichen Niederlage Röttgens gebastelt, damit Plasberg ihn fragen kann, ob er sich das auch gut überlegt hat.
Oder der Einspielfilm, in dem gezeigt wurde, dass auch gegen umweltverträgliche Arten der Energiegewinnung immer irgendwo Naturschützer demonstrieren – als sei das keine Binse, als bestünde Politik nicht immer daraus, Abwägungen zu treffen, als belege der Protest gegen ein Wasserkraftwerk irgendwo, dass die Technik auch nicht verträglicher ist als Atomkraft.
Man müsste mal die Eierlikör-Vorräte in der Redaktion von „Hart aber fair“ kontrollieren, oder welche Drogen auch immer zu der Idee geführt haben, dem Umweltminister drei Landschaftsaufnahmen von Brücken zu zeigen, damit er auswählt, welche seiner Vorstellung vom Einsatz der Atomenergie als Brücken-(!)-Technologie entspricht (Plasberg: „A, B oder C, Herr Röttgen!“).
Es war eine lächerliche einhundertste Sendung im Ersten, die wie eine doppelte Karikatur wirkte. Eine Karikatur auf eine Berichterstattung über Politik, die nur noch daraus besteht, Haltungsnoten zu verteilen. Jeden der erstaunlich zahlreichen Versuche seiner Gäste, über Inhalte zu reden, blockte Plasberg ab und führte die Diskussion auf Stilfragen zurück. Und eine Karikatur auf das, was aus „Hart aber fair“ geworden ist: Die Karnevalsversion einer politischen Talkshow, bestehend nur aus Mätzchen und einer endlosen Abfolge von Tä-täääs. Plasberg stellte Röttgen mit ernster Sinnlosigkeit Fragen wie: „Welche Note würden Sie sich in Rhetorik geben“ und: „Können Sie Kanzler“ – und legte dann treuherzig nach, warum es „politischer Selbstmord“ für einen Politiker wäre, die Frage zu beantworten, als wäre seine Redaktion nicht die erste, die ein entsprechend selbstbewusstes Bekenntnis einem Gast in einem lustigen Einspielfilm immer wieder als selbstmörderische Hybris vorhalten würde…
… was zufällig ein Begriff ist, der einem einfallen kann, wenn man die Interviews liest, die Plasberg zur Jubiläumsshow gegeben hat. Natürlich entspricht es dem üblichen Medienzyklus, dass viele Kritiker den Mann nach Jahren des Lobs jetzt nicht mehr gut finden. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht stimmt.
[via Andrew Sullivan]