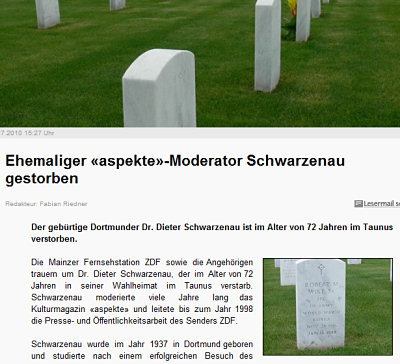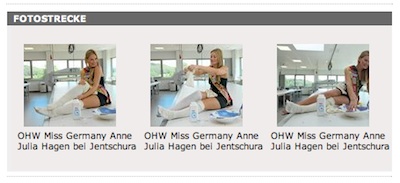Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Ein einziger Blick in die Zukunft hätte doch gezeigt… Wie Journalisten nach dem Unglück auf der Duisburger Loveparade zu selbstgerechten Propheten der Rückschau wurden.
· · ·
Wenn Journalisten diese Loveparade organisiert hätten, wäre das nicht passiert.
Ungefähr in der Sekunde, in der am Samstag voriger Woche bekannt wurde, was für eine Katastrophe sich in Duisburg ereignet hatte, schlich sich in die Berichterstattung der Gedanke ein, dass genau eine solche Katastrophe absehbar gewesen sei. Bereits in der Live-Berichterstattung des WDR am frühen Abend, als die Moderatoren im Studio und die Reporter vor Ort noch so gut wie nichts wussten, fielen angesichts von Meldungen von Absperrungen erste Formulierungen wie: „Man fragt sich natürlich: Was war das für eine Idee? Das musste doch schiefgehen!“
Später empörten sich Journalisten, dass das doch klar war, dass 1,4 Millionen Menschen nicht auf diesen Platz passen würden (das war, bevor sich herausstellte, dass es viel weniger waren, wobei die Journalisten dann natürlich auch wussten, dass Veranstalter diese Zahlen immer übertreiben). Und schließlich reichte angeblich ein Blick auf eine Karte der Örtlichkeiten, um zu wissen, dass das nicht gutgehen konnte.
Jeder Laie schreibt und sendet, dass jeder Laie das unausweichliche Unglück hätte erkennen können, und die Laien, die als Journalisten arbeiten, fragten schnell, warum das niemand von den Verantwortlichen erkannt hat. Weitgehend ungestellt blieb die Frage, warum, wenn die Mängel so unübersehbar waren, all die Journalisten sie vorher übersehen hatten. Und ob man zu den vielen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden, nicht auch die Medien zählen muss.
Ausgenommen natürlich Götz Middeldorf, den Duisburger Lokalchef der „Neuen Ruhr Zeitung“ (NRZ). Die „International Herald Tribune“ zitierte ihn mit den Worten: „Wir waren die einzige Zeitung, die gesagt hat: Nein. Stoppt das. Die Stadt ist nicht vorbereitet. Wir können nicht mit diesen ganzen Leuten fertigwerden.“
Fragt man Middeldorf nach dem entsprechenden Artikel, faxt er einem tatsächlich einen Kommentar vom 3. Dezember 2009 mit der Überschrift: „Stoppt die Loveparade!“ In dem geht es aber mit keinem Wort um die Frage, ob die Stadt für so viele Besucher gerüstet ist. Es geht ausschließlich ums Geld. „Es ist grotesk, ja geradezu pervers“, empörte sich Middeldorf damals, „den Duisburgern über Jahre millionenschwere Kürzungen im Bildungs- und Kulturbereich zuzumuten und zumeist ortsfremden, feierwütigen Jugendlichen einen Tag zum Abfeiern zu bieten.“
Auf Nachfrage räumt Middeldorf ein, dass Sicherheitsbedenken nicht das Thema waren. „Wir waren immer gegen die Loveparade, aber aus anderen Gründen.“ Dann muss die „International Herald Tribune“ ihn mit seinem Lob für die eigene, einzigartige Weitsichtigkeit wohl falsch verstanden haben? „Das vermute ich mal“, antwortet Middeldorf. „Das ist nicht ganz richtig.“ Er klingt nicht zerknirscht.
Er findet dann immerhin noch den Kommentar eines Kollegen, der „eine Party mit Millionen-Publikum neben einer Hauptverkehrsstrecke der Deutschen Bahn“ als „ein Riesenproblem“ bezeichnet hatte. Unaufgefordert schickt seine Redaktion schließlich noch einen Artikel von der Konkurrenz: aus der „Rheinischen Post“ vom 28. Januar. Darin stellt die Zeitung in der Debatte um die Loveparade in Duisburg „Vorurteile“ „Fakten“ gegenüber.
Das liest sich so: „Vorurteil: Die Sicherheit der Besucher, besonders am Ex-Güterbahnhof, ist nicht gewährleistet. Fakt: An den vorbereitenden Gesprächen waren unter anderem auch Polizei, Autobahnpolizei, städtisches Dezernat für Recht und Sicherheit, Feuerwehr und Zivilschutzamt, Ordnungsamt, [die Bahn-Immobilientochter] Aurelis, Bahn AG, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und die Duisburger Verkehrsgesellschaft beteiligt. Die Experten halten die Loveparade in Duisburg im Hinblick auf Sicherheit grundsätzlich für machbar.“
Vielleicht sagt das Fehlen von Recherchen und kritischen Würdigungen des Sicherheitskonzeptes vor dem Ereignis etwas aus über den Zustand des Lokaljournalismus. (WDR und Bild.de waren Medienpartner und also in der Rolle der Jubelperser.) Ganz sicher aber sagt die fehlende Auseinandersetzung der Medien mit ihrem Versagen etwas aus über ihr Selbstverständnis.
Ein einziger Artikel im Internetangebot der WAZ-Gruppe muss als Beleg dafür dienen, dass die Medien vorher schon vor Problemen gewarnt haben. Er referierte mit leichter Skepsis fünf Tage vorher den Optimismus der Planer und trägt die Überschrift „Loveparade wird zum Tanz auf dem Drahtseil“. Unter diesem Artikel finden sich auch mehrere Leserkommentare, die die Planungen als äußerst riskant bewerten – und die im Nachhinein nun wiederum als Beweis dafür gewertet wurden, dass man es vorher hätte wissen müssen.
So wie viele Medien in dem Moment, in dem die Katastrophe passiert war, wussten, dass sie passieren musste, erwarteten sie auch von den Beteiligten unmittelbar Antworten und Schuldbekenntnisse. Keine Frage: Die Pressekonferenz, die Stadt, Behörden und Veranstalter am Sonntagmittag abhielten, war erschütternd. Aber der Anspruch von Medien, angetrieben durch die Taktgeber von „Spiegel Online“, dass keine vierundzwanzig Stunden nach einem solchen Ereignis keine Fragen offen bleiben dürfen, spiegelte nicht nur das Quengeln einer unter Aufmerksamkeits-Defizit-Störung leidenden Branche wider, sondern auch die ganze Anmaßung der Rolle als Ankläger, die viele Medien nun eingenommen hatten – und sich irgendwann mit der Forderung nach Rücktritten zufriedengaben. (Götz Middeldorf, natürlich, der in seiner Rücktrittsaufforderung an den Oberbürgermeister schrieb: „Sie haben die Augen verschlossen vor möglichen Risiken, die nicht nur im NRZ-Internetportal Der Westen seit Wochen geäußert wurden.“ Middeldorfs eigene geschlossene Augen sind offenbar weder der Rede noch des Rücktritts wert.)
Es ist eine bemerkenswerte Selbstgerechtigkeit, die durch viele Berichte schimmert, befeuert durch publizistische Glücksfälle wie den, dass der neue Loveparade-Veranstalter Rainer Schaller sein Engagement einmal als „Himmelfahrtskommando“ bezeichnet hatte. Reflexartig wiederholt wurde auch die angebliche Ultra-Kommerzialität der Veranstaltung – ein Vorwurf, den man trotz freien Eintritts anscheinend nicht einmal belegen muss. „Monitor“ fand es irgendwie schon anrüchig, dass ein Limonadenhersteller als Sponsor einen „fünfstelligen Beitrag“ zahlte. Der Vorwurf der Geldmacherei gipfelte auf paradoxe Art darin, zu erwähnen, dass Schaller die Loveparade Millionen koste, die er aber als Verlust von den Steuern abziehen könne. Für „Spiegel-TV“ ist das gar „die einzig gute Nachricht an diesem Wochenende in Duisburg: Der kommerzielle Massenwahn hat keine Zukunft mehr.“
Die Leute von „Spiegel-TV“ waren mit vielen Kameras vor Ort, um eigentlich ihre übliche herablassende Event-Reportage zu produzieren. Sie waren sich im Rausch des Schreckens für nichts zu schade. „Die Marke Loveparade wird für immer überschattet von einem einzigen tödlichen Wort“, knarzt der Sprecher am Anfang: „Duisburg.“ Die Gesichter haben sie unkenntlich gemacht, immerhin, aber sonst zeigen sie alles: Wir sehen die verzweifelten Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort und das Durcheinander in der Notaufnahme („Emergency Room Duisburg“), wo die „Spiegel-TV“-Leute allem Anschein nach Ärzte von der Arbeit abhalten.
Die Reportage erzählt das Geschehen vor der Katastrophe in dem Wissen um das, was später passieren wird. Schon das Aufstellen von Absperrungen hat da etwas Anrüchiges: „Auch die Polizei glaubt noch, etwaige Probleme mit Gittern aus Eisen lösen zu können“, kommentiert der Sprecher. Was nicht passt, wird passend gemacht: Zu Szenen, wie sich verzweifelte Menschen gegenseitig helfen, heißt es: „Es herrscht das Gesetz des Stärkeren. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod in einer Menschenmenge außer Kontrolle.“ Die üblichen Kriterien bei der Auswahl, wer zuerst behandelt wird, werden bedeutungsschwanger zu einer „Methode der Militärmedizin“, denn natürlich: „Es sind Szenen wie im Krieg.“
Das als „Rekonstruktion“ verbrämte Machwerk zeigt, wie am Morgen im Bahnhof ankommende Jugendliche von Polizisten gebeten werden, das Rauchverbot zu beachten. Der Kommentar dazu lautet: „Eine tragische Geste der Ordnungsmacht, angesichts der Ereignisse, die die Stadt wenige Stunden später erschüttern wird.“ Man könnte diesen Satz sinnlos nennen, frivol oder zynisch. Er wirkt auch als Symbol für die Haltung einer Branche, die hinterher immer alles schon vorher gewusst hat.