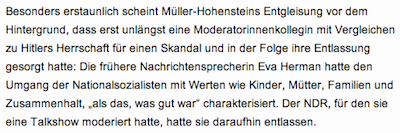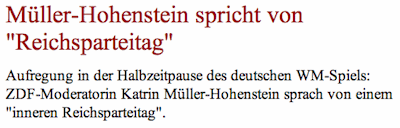Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Der werberelevante Zuschauer altert: aus „14-49“ könnte „20-59“ werden.
Jetzt will es natürlich keiner gewesen sein. Die werbungtreibende Industrie erklärt, sie hätte sich noch nie auf die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen fixiert. Die Agenturen, die die Fernsehspots buchen, erklären, sie würden sich ohnehin je nach Auftraggeber ganz spezielle Zielgruppen ansehen. Und große private Fernsehsender wie RTL erklären, sie machten ohnehin Programm auch für die Zuschauer jenseits der fünfzig – würden sie sonst bei einer Sendung wie „Let’s Dance“ auch Kandidatinnen wie Heide Simonis oder Katja Ebstein einladen? Also.
Dabei war und ist „14-49“ das Maß aller Dinge; der Gott, dem das Programm als Opfergabe dargebracht wurde. Ungezählte Fernsehmenschen beginnen ihren Arbeitstag damit, morgens auf dem Blackberry oder mit zitternder Fernbedienung im Videotext nachzuschlagen, welche Marktanteile in dieser Altersgruppe ihre Sendungen am Tag zuvor erzielten. Mediendienste erstellen täglich Hitlisten, die auf diesen Werten basieren, küren danach Quotensieger und Flops. Die Sender schicken Pressemitteilungen in die Welt, in denen sie kunstvoll aus den Werten und Veränderungen hinter dem Komma Erfolgsmeldungen stricken. Bei RTL 2 richtete sich früher sogar der Preis des Essens in der Kantine nach dem Marktanteil von „Big Brother“ am Vortag.
Rational erklären ließ sich diese Fixierung noch nie. Es war eine Konvention – so wie die Verabredung, das Gewicht von Gegenständen in Kilogramm zu messen, der Masse von einem Liter Wasser, oder die Länge in Meter, einem willkürlich bestimmten Bruchteil des Erdumfangs. Die Einheit „14-49“, die in Deutschland vor allem von RTL-Gründungschef Helmut Thoma propagiert wurde, diente vor allem einem Ziel: den im Gesamtpublikum noch schwachen Sender im Vergleich zu ARD und ZDF gut dastehen zu lassen. Womöglich ließ sich damals, Ende der achtziger Jahre, auch noch erklären, warum Über-Fünfzigjährige so anders sein sollen als die darunter: Es war grob die Grenze zur Nachkriegsgeneration.
Heute hat die Altersgruppe der Fünfzig- bis Sechzigjährigen viel Geld, ist flexibel und aufgeschlossen für Werbung. Und der einzige Grund, sie nicht in die zentrale Vergleichsgröße des Fernsehens einzubeziehen, ist der, dass man das bislang auch nicht gemacht hat.
Die Beharrungskräfte des Systems sind enorm, und über die Sinnlosigkeit der Größe „14-49“ ist schon oft folgenlos diskutiert worden. Doch diesmal könnte es anders sein. Diesmal ist nämlich RTL eine treibende Kraft. Der Sender und seine Vermarktungstochter IP schlagen eine Verschiebung der „werberelevanten Zielgruppe“ vor: 20 bis 59 soll die neue Einheit sein.
Bei der ARD-Werbung freut man sich. „Es ist durchaus gerechtfertigt, dass diejenigen, die diesen Unsinn in die Welt geschafft haben, ihn auch wieder beseitigen“, sagt ihr Geschäftsführer Dieter Müller auf RTL gemünzt. Die neuen Altersgrenzen seien aus Sicht der Werbeindustrie auch einigermaßen logisch zu erklären: Teenager haben zumeist nur Taschengeld zur Verfügung, und ab sechzig steigt schnell der Anteil derjenigen, die auch nur über ein reduziertes Einkommen verfügen.
Die Verschiebung der Einheit, auf welcher „der komplette vergleichende Wettbewerb basiert“, wie Müller sagt, wäre nur eine überfällige Anpassung an die demographische Realität. Sie ist deshalb auch im Interesse des Mediums: Die Zahl der 14- bis 49-Jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Die schönen Prozentzahlen entsprechen immer weniger tatsächlichen Fernsehzuschauern, die man den Werbekunden in Rechnung stellen kann.
Das ist vermutlich auch ein Grund, warum RTL sich plötzlich für eine Veränderung starkmacht, von der der Sender selbst oberflächlich gesehen gar nicht profitiert. Gemessen in der neuen Bezugsgröße wäre der Sender zwar immer noch mit großem Vorsprung Marktführer, würde aber Anteile verlieren (siehe Tabelle). Noch erheblich mehr schrumpft aber Pro Sieben – eine Folge davon, dass der Sender zwar erfolgreich junge Zuschauer anspricht, aber auch nur die. Plötzlich erschiene ein breiter aufgestellter Sender wie Vox, der nach bisheriger Rechnung in einer anderen, kleineren Liga spielt, in Reichweite. Der Effekt wäre vor allem ein psychologischer: Pro Sieben würde sich mit Sicherheit auch in Zukunft auf die Ansprache junger Zielgruppen konzentrieren. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung und den täglichen Quotenauswertungen würde die Bedeutung des Senders auf ein realistischeres Maß als Beinahe-Spartenkanal schrumpfen.
Die Sendergruppe Pro-SiebenSat.1 tut sich deshalb schwer mit dem Vorschlag, die angeblich „werberelevante Zielgruppe“ nach oben zu verschieben. Dabei würde Sat.1 als älterer Sender davon sogar im Gegensatz zu RTL profitieren. Senderchef Andreas Bartl hatte kürzlich erst öffentlich beklagt, dass die 50- bis 59-Jährigen, die Sat.1 erreicht, den Werbekunden „fast geschenkt“ werden, und gab als Ziel aus, diese Reichweiten „besser zu kapitalisieren“.
Trotzdem erklärt ein Sprecher des Vermarkters Seven One Media, das Thema sei erledigt – ohne einen der beiden großen Privatsenderblöcke ließe sich so eine Änderung nicht durchsetzen, und man sei halt dagegen. Bei einer Sprecherin von Pro-Sieben-Sat.1 klingt es etwas weniger harsch: Eine Neudefinition sei im Moment kein Thema. Aber das könne in zehn Jahren anders sein. Oder in fünf. Oder nächstes Jahr.
Es scheint also nur jetzt gerade irgendwie ein schlechter Zeitpunkt zu sein; vielleicht liegt’s am Wetter.
Die großen Gewinner einer Umstellung wären scheinbar ARD und ZDF. Aber die Berechnung nach „20-59“ legt auch offen, wie überaltert das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen wirklich ist. Auch in einer solchen Währung, die den breiten Kern der arbeitenden Bevölkerung abbildet, landen ARD und ZDF abgeschlagen hinter RTL, Sat.1 und Pro Sieben auf den Plätzen. Denn die Masse der öffentlich-rechtlichen Zuschauer ist nicht Mitte fünfzig, sondern weit über sechzig. Anders als bisher ließen sich diese Werte nicht einfach abtun als Ausdruck einer bizarren Verengung auf eine künstlich geschaffene junge Zielgruppe. Es würde deutlich, wie wenig es den öffentlich-rechtlichen Sendern, die von allen bezahlt werden, gelingt, ein Programm zu machen, das auch alle anspricht.
Der Mythos „14-49“ ist nicht zuletzt für diejenigen ein psychologisches Problem, die diese Altersgruppe verlassen und darunter leiden, dass der Schock, fünfzig zu sein, noch dadurch verstärkt wird, dass sie glauben, nun würde nicht einmal mehr Fernsehen für sie gemacht! Doch auch wenn ihr Zuschauerverhalten plötzlich in den täglichen Standardauswertungen enthalten wäre, würde sich das Programm nicht radikal ändern. So groß unterscheiden sich die Mittfünfziger und ihr Fernsehkonsum nämlich gar nicht von den Mittvierzigern – genau diese Ähnlichkeit im Verhalten spricht ja paradoxerweise dafür, sie mit in die Zielgruppe aufzunehmen. Das Interesse an amerikanischen Serien wie „CSI“ oder „Monk“ auf RTL zum Beispiel reißt relativ abrupt erst ab 60 oder 65 Jahren ab; und eine Show wie „Wer wird Millionär“ kommt in allen Altersgruppen an.
Eine Revolution bliebe aus, und doch würde die Macht des Faktischen in einer Branche, die ununterbrochen auf Zahlen starrt und ihre Entscheidungen davon abhängig macht, zu Veränderungen führen. Auf Dauer würden Programme stärker belohnt, die ein breites Publikum ansprechen; Sendungen mit jungem Altersdurchschnitt, wie „Deutschland sucht den Superstar“, würden die täglichen Erfolgsmeldungen etwas weniger dominieren. Dennoch sieht man auch bei der Ufa Film- & Fernsehproduktion, die unter anderem diverse Daily Soaps herstellt, einer Änderung gelassen entgegen – obwohl deren Marktanteile sänken. Man brauchte dann nur eine Ansage der Sender, ob die Serien auf die neue Zielgruppe optimiert werden sollen, sagt Ufa-Forschungschef Rainer Hassenewert – dann könne man auch entsprechend „breiter“ produzieren. Oder es ließen sich gezielt die als Trendsetter begehrten Jungen ansprechen.
Ein Gremium, das „20-59“ formal beschließen könnte, gibt es nicht – die großen Sender und ihre Vermarkter müssten sich bloß absprechen und auf die neue Standardwährung verständigen. Ein Sender von der Größe wie RTL könnte aber auch einfach damit anfangen. Die Argumente hätte er eh auf seiner Seite.