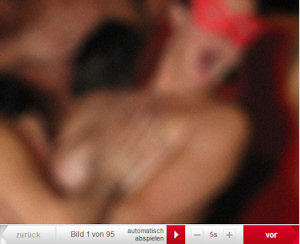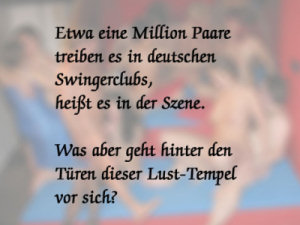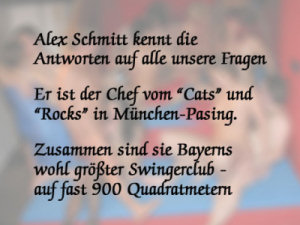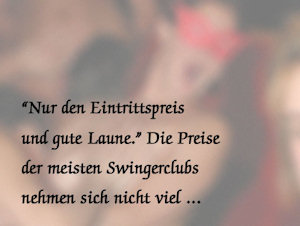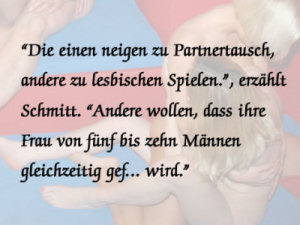[Vorbemerkung: Die Kanzlei von Christian Schertz hat mich in mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen vertreten; er hat mich und BILDblog unterstützt. Ich habe mich jedoch vor einiger Zeit entschlossen, seine Dienste nicht mehr in Anspruch zu nehmen.]
Der prominente Berliner Medienanwalt Christian Schertz ist gestern vorläufig mit dem Versuch gescheitert, einen hartnäckigen kritischen Berichterstatter gerichtlich zum „Stalker“ erklären zu lassen und dadurch mundtot zu machen.
Es ist eine in vielfacher Hinsicht bizarre und beunruhigende Auseinandersetzung. Schertz fühlt sich von Rolf Schälike verfolgt, einem Mann, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Verhandlungen der Hamburger und Berliner Pressekammern zu dokumentieren, in deren Rechtsprechung er regelmäßig eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sieht und die er „Zensurkammern“ nennt. Die Kanzlei Schertz Bergmann und andere nennt er entsprechend „Zensurkanzleien“, Schertz selbst einen „Zensurguru“.
Schertz hat Schälike, der im Gerichtssaal bei den Verhandlungen mitprotokolliert und meist schwer verständliche Texte auf seiner Seite „Buskeismus“ veröffentlicht, mit einer Flut von Klagen überzogen. Es geht dabei nicht nur um (angebliche oder tatsächliche) Beleidigungen, sondern auch um die Frage, ob es ein so einflussreicher Anwalt hinnehmen muss, dass sein Vorgehen vor Gericht dokumentiert und somit einer kritischen Bewertung durch die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Nachdem Schälike dann natürlich auch über die Prozesse berichtet hat, die diese Frage verhandeln, ist Schertz auch dagegen vorgegangen. Im Klartext: Er versucht Schälike nicht nur zu untersagen, über ihn zu berichten; er versucht auch, ihm zu untersagen, darüber zu berichten, dass er versucht, ihm zu untersagen, über ihn zu berichten.
Der 71-jährige Rolf Schälike ist ein anstrengender Mensch, der sich mit einem gewissen Wahn dem Thema widmet und dabei zweifellos häufiger über das Ziel hinaus schießt. Aber auch das Verhalten von Christian Schertz lässt sich rational kaum noch erklären. Er aber geht nicht nur gegen Schälike vor, sondern nach meiner Überzeugung auch gegen die Meinungsfreiheit. (Er hat sogar versucht, gegen einen Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über Schälike vorzugehen, in dem er namentlich nicht einmal genannt wird, weil er meinte, dass Leser glauben könnten, er stecke hinter dem anonymen Zitat eines anderen Anwaltes.)
Anfang 2009 griff Schertz, offensichtlich beeindruckt von der Renitenz Schälikes, der sich auch durch horrende Rechtskosten nicht einschüchtern ließ, zu einem neuen, originellen und drastischen Mittel: das Gewaltschutzgesetz. Es ist erst vor wenigen Jahren verabschiedet worden, um Opfer von häuslicher Gewalt und Stalkern besser zu schützen. Der mächtige Anwalt Christian Schertz erklärte sich zum Stalking-Opfer des Bloggers Rolf Schälike und forderte den Schutz des Staates. Er berief sich dabei auf die Gesetzes-Formulierung, wonach ein Gericht ermächtigt ist, gegen jemanden vorzugehen, der „eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklich erklärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln verfolgt“. Belästigt fühlte sich Schertz unter anderem durch eine E-Mail Schälikes und eine merkwürdige Weihnachtskarte.
Das Amtsgericht Charlottenburg lehnte die von Schertz beantragte einstweilige Verfügung gegen Schälike ab, das Landgericht Berlin gab sie ihm, allerdings mit einer Befristung auf sechs Monate. Es verbot Schälike unter anderem, in dieser Zeit „in irgend einer Form Kontakt zu dem Antragsteller aufzunehmen, etwa durch persönliche Ansprache, Telefonat, Fax, SMS, Email, Grußkarten oder Briefsendungen“ sowie sich Schertz „auf weniger als 50 m zu nähern; bei zufälligen Begegnungen ist der Abstand von 50 m durch den Antragsgegner unverzüglich wieder herzustellen“. Damit durfte sich Schälike auch nicht mehr im Gerichtssaal aufhalten, wenn Schertz anwesend war.
Diese Verfügung wurde sechs Wochen später, am 28. April 2009, nun wieder vom Amtsgericht Charlottenburg gekippt, wogegen Schertz Berufung einlegte.
Schertz Berufungsantrag wurde nun gestern vom Landgericht Berlin als unzulässig abgelehnt.
Es scheint, als wären Schertz dabei seine eigenen juristischen Kniffe zum Verhängnis geworden. Die Richterin machte deutlich, dass sie das Vorgehen seiner Kanzlei höchst zweifelhaft fand. Schertz forderte im Grunde, eine einstweilige Verfügung wieder in Kraft zu setzen, die aber ohnehin nicht mehr gelten würde, weil ihre sechsmonatige Befristung längst abgelaufen ist. Seine Rechtsvertreterin (Schertz war selbst nicht anwesend) verwickelte sich beim Versuch, ihren Berufungsantrag nachträglich so umzuformulieren, dass sie vom Gericht nicht sofort aus formalen Gründen abgewiesen wird, in heillose Widersprüche. Ursprünglich hatte sie gefordert, dass die Stalking-Vorgaben für Schälike unbefristet gelten sollen. Dann sprach sie davon, dass sechs Monate, wie sie das Landgericht vorgegeben hatte, ausreichten: In dieser Zeit der Zwangstrennung könne Schälike ja vielleicht vernünftig werden. Diese sechs Monate müssten aber natürlich ab jetzt erst gelten, nicht vom Zeitpunkt im vergangenen Jahr, zu dem die einstweilige Verfügung erlassen wurde.
Ihre Argumentation war außerordentlich perfide: Wie notwendig und positiv die einstweilige Verfügung sei, zeige sich daran, dass sie auf Schälike offenbar „starke Wirkung“ gehabt habe, sagte sie. — Als könnte die „starke Wirkung“, nämlich die gewaltige Empörung des Gegners, nicht auch damit zu tun haben, dass sich jemand, der sich bloß als radikaler Kämpfer für Transparenz und Meinungsfreiheit sieht, plötzlich vorwerfen lassen muss, er sei ein „Stalker“. Oder damit, dass Rolf Schälike mangels Meinungsfreiheit in der DDR zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und zehn Monate im Stasi-Gefängnis saß, und es einfach nicht fassen kann, dass ihm in der Bundesrepublik sein Recht auf freie Meinungsäußerung in solcher Form genommen werden soll.
Bemerkenswert ist auch, dass die ganze Sache nach weit über einem Jahr immer noch im einstweiligen Verfahren verhandelt wird, das eigentlich nur dafür da ist, Entscheidungen vorläufig und auf die Schnelle zu treffen. Eberhard Reinecke, der Anwalt von Rolf Schälike, sah darin den Versuch, eine „ordnungsgemäße Beweisaufnahme zu verhindern“. Zu einer solchen Verhandlung, in der zum Beispiel anhand von Zeugenaussagen geklärt würde, was an den Stalking-Vorwürfen von Schertz gegen Schälike dran ist, käme es erst in einer Hauptverhandlung. Dazu müsste Schertz in der Hauptsache klagen, was ihm auch das Gericht nahelegte. „Sie können nur gewinnen, wenn Sie überfallartig arbeiten“, warf Anwalt Reinecke der Vertreterin von Schertz vor, weil dessen Kanzlei nach Monaten der Funkstille einen Tag vor der Verhandlung plötzlich einen gewaltigen Schriftsatz produziert hatte.
Am Ende hätte sich Schertz‘ Kanzlei diese Papierverschwendung sparen können: Das Landgericht urteilte gar nicht in der Sache, ob das Verhalten von Schälike Schertz gegenüber als „Stalking“ im Sinne des Gesetzes gewertet werden kann (was die Vorinstanz für mich überzeugend verneint hat). Es lehnte die Berufung schon aus formalen Gründen ab. Im Gerichtssaal in Berlin-Mitte erschien das wie eine besonders peinliche Form der Niederlage für die vermeintlichen Rechtsprofis der Kanzlei Schertz Bergmann.
PS: Christian Schertz hat mir gegenüber gestern nicht nur angekündigt, jeden Satz in diesem Text auf sachliche Fehler zu prüfen und gegebenenfalls dagegen juristisch vorzugehen. Der bekannte Anwalt glaubt außerdem, dass sein Geschäftsgebaren nicht öffentlich erörtert werden dürfe. Er behielt sich ausdrücklich vor, gegen diesen Eintrag rechtlich vorzugehen, wenn ich ihn nicht anonymisiere.
Ich bin überzeugt, dass es legitim ist, seinen Namen zu nennen. Schertz tritt regelmäßig als Experte für Medienrecht öffentlich auf. Der Versuch, das Gewaltschutzgesetz zu nutzen, um gegen wiederholte Äußerungen von Kritikern vorzugehen, ist, neutral formuliert, innovativ — eine Tatsache, auf die Schertz selbst stolz ist. Und wenn Schertz sich mit seinem Vorgehen durchsetzt, wonach es zum Glück gerade nicht aussieht, stellt das eine ernste Bedrohung der Meinungsfreiheit dar.
Immerhin hat das Landgericht Berlin Anfang des Jahres in einer anderen Sache Schertz ./. Schälike geurteilt, dass der Anwalt kritische Berichterstattung akzeptieren müsse: Ein Gewerbetreibender habe eine der Wahrheit entsprechende Kritik an seinen Leistungen grundsätzlich hinzunehmen. Für Anwälte gelte nichts anderes.
Nachtrag, 14:20 Uhr. Janus hat ein schönes, altes Zitat von Schertz zum Thema ausgegraben. Im April 2005 berichtete die Nachrichtenagentur ddp:
Der Berliner Medienanwalt Christian Schertz hat den am Freitag von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) vorgestellten Entwurf für ein Stalking-Gesetz kritisiert. Das Gesetz sei handwerklich unsauber, sagte Schertz der „Berliner Zeitung“ (Samstagausgabe) laut Vorabbericht. Es enthalte Formulierungen, die zu wenig präzise seien.
„Im Strafrecht muss der Bürger genau wissen, wann er eine Straftat begeht“, sagte Schertz. Der Entwurf von Zypries sieht vor, für andauernde Belästigungen wie ständige Anrufe oder das Auflauern vor der Haustür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu verhängen. Dafür müsse das Stalking-Opfer „schwerwiegend und unzumutbar“ in seiner Lebensgestaltung beeinträchtigt sein. „Wann beginnt da der Tatbestand?“ kritisierte Schertz die Formulierung.