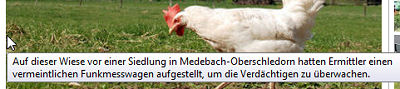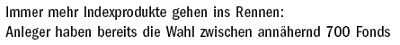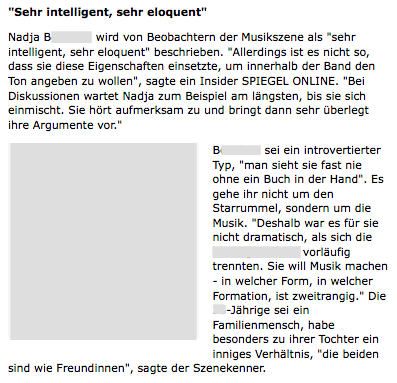Eine erfolgreiche Popsängerin ist verhaftet worden. Ihr wird vorgeworfen, mindestens einen Sexualpartner mit HIV infiziert zu haben.
Müssen die Medien darüber berichten dürfen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine andere Frage: Müssen die Medien darüber berichten?
Ich bin mir wirklich unsicher, ob die Entscheidung des Berliner Landgerichtes gerecht ist, der „Bild“-Zeitung jede identifizierende Berichterstattung über den Fall zu untersagen. Aber es fällt auf, dass diejenigen, die die einstweilige Verfügung für falsch oder skandalös halten, ihr Urteil weniger mit dem konkreten Fall begründen, als mit der grundsätzlichen Frage. Wenn man über diese Sache nicht berichten dürfe, dann könne man, wie „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann mit dem Argumentationsmuster eines Sechsjährigen sagt, „die Pressefreiheit auch gleich abschaffen.“
Natürlich darf man, wenn man will, in der Entscheidung des Berliner Gerichts eine Grundsatzentscheidung sehen und fragen, ob Gerichte, die so urteilen, nicht auch legitime oder gar notwendige Berichterstattung in anderen Fällen unterbinden. Es ist nur schwer, am konkreten Fall zu begründen, warum die Öffentlichkeit ein verdammtes Recht darauf hat, zu erfahren, dass eine Sängerin verdächtigt wird, vor Jahren ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Partner gehabt zu haben, obwohl sie gewusst habe, HIV-positiv zu sein.
Das häufigste Argument, das auch „Bild“ heute wieder ins Feld führt, ist das von der „Vorbildfunktion“, die Prominente für junge Menschen hätten, plakativ illustriert mit der Zahl der Poster der Frau, die angeblich in deutschen Kinderzimmern hängen. Woher kommt der absurde Gedanke, dass ausgerechnet Popstars eine Vorbildfunktion haben? Ist ihre Funktion nicht seit Jahrzehnten, durch asoziales und verantwortungsloses Verhalten als schlechtes Beispiel zu dienen, vor dem die Eltern ihre Kinder warnen können? Und ist es nicht genau das, was sie für Jugendliche zu Idolen macht?
Ich verstehe das mit dem Vorbild noch, wenn wir zum Beispiel darüber reden, ob ein Fußballer dafür bestraft werden muss, weil er auf dem Platz tätlich geworden ist. Die jungen Menschen, die diese Sportler anhimmeln, sollen lernen, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist und negative Folgen hat, selbst für so coole Leute wie Lukas Podolski. (Im Idealfall.)
Wenn es überhaupt eine stille Übereinkunft gibt zwischen der Gesellschaft und den Menschen, die erfolgreich genug sind, um aus ihr herauszuragen, dann doch die, dass die Prominenten sich dann vorbildlich verhalten sollen, wenn sie in dieser Öffentlichkeit sind oder ihr Verhalten diese Öffentlichkeit betrifft. Aber erwarten wir allen Ernstes von einem Menschen, dass er von dem Moment an, in dem er ein bestimmtes Maß an Erfolg hat, sich privat anders, besser verhält? Wenn ja: Warum?
Schadet es der Jugend, ein Idol anzuhimmeln, dessen privater Lebenswandel alles andere als vorbildlich ist — solange dieses Privatleben gar nicht bekannt ist? Und inwiefern hilft es dann, dieses Privatleben öffentlich zu machen? Inwiefern ist den nach Vorbildern suchenden Jugendlichen im konkreten Fall jetzt damit gedient, dass sie wissen, dass ihrem Star gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird?
Geht es da um eine Form von Gerechtigkeit: Dass niemand wegen seiner Karriere und seiner halbfiktiven öffentlichen Figur angehimmelt wird, der das, wenn man seine ganze Persönlichkeit kennt, gar nicht verdient hätte? Oder geht es sogar nur darum, Verfehlungen von Prominenten öffentlich zu machen, damit andere Prominente davon abgeschreckt werden, sich ebenfalls nicht-vorbildlich zu verhalten?
Immer wieder ist zu hören, dass berühmte Menschen davon leben, dass die Öffentlichkeit sich für sie interessiert, und es deshalb auch hinnehmen müssen, dass die Öffentlichkeit auch unangenehme Dinge über sie erfährt. Ich habe diese Argumentation noch nie verstanden. Dadurch, dass ich die Musik von jemandem mag, dadurch, dass ich die Platte von ihm kaufe, und womöglich noch dadurch, dass ich eine Zeitschrift kaufe mit bunten Fotos von ihm, erwerbe ich einen Anspruch darauf, zu erfahren, was er privat treibt? Weil die Prominenten uns brauchen und wir sie überhaupt erst zu Prominenten machen, gehören sie uns mit Haut und Haar?
Für mich klingt das nach Neid. Es klingt danach, dass wir diesen Menschen die Vorteile, die mit ihrem Berühmtsein verbunden sind, verübeln und wollen, dass sie wenigstens auch Nachteile dafür in Kauf nehmen sollen. Was haben, um zwei der extremsten Fälle zu nehmen, Britney Spears und Amy Winehouse uns getan, dass wir sie von widerlichen Fotografen verfolgen lassen, rund um die Uhr, damit sie sie in ihren dunkelsten Momenten ablichten und wir uns daran ergötzen können? Was schulden diese Menschen uns dafür, dass wir sie zu Stars gemacht haben?
Jeder nicht-prominente Mensch, dem das gleiche vorgeworfen wird wie der Sängerin im aktuellen Fall, müsste mit einer Bestrafung durch die Justiz rechnen, aber nicht damit, dass das ganze Land von seinem mutmaßlichen Vergehen und seinem HIV-Status erfährt. Ist das irgendeine Form von ausgleichender Gerechtigkeit dafür, dass jeder nicht-prominente Mensch auch sein privates Glück nicht mit der halben Nation teilen kann, sondern nur mit seinen Freunden oder Bekannten?
Die Pressefreiheit schützt nicht nur die seriöse Zeitung, die zur Willensbildung beiträgt und für das Funktionieren einer Demokratie unerlässlich ist. Sie schützt auch das Schundblatt, das mit dem privaten Elend von Menschen und versehentlich oder absichtlich entblößten sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmalen Auflage macht. Insofern ist ein Angriff auf das Schundblatt auch ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Für Joachim Jahn, meinen Blognachbarn bei FAZ.net, scheint die einstweilige Verfügung des Berliner Landgerichts gegen „Bild“ sogar schon „Das Ende der Pressefreiheit“ zu bedeuten. Das kann ich wenigstens theoretisch noch halbwegs nachvollziehen. Erstaunlich finde ich aber, wie unverwandt er zu dem Ergebnis kommt, es sei „schlichtweg absurd“, dass die Richter „das Persönlichkeitsrecht der Sängerin für wichtiger halten als eine Berichterstattung über die Verhaftung und ihren Anlass“.
Solche Abwägungen zwischen zwei Rechtsgütern sind immer merkwürdig fiktiv, aber aus der Sicht des juristischen Laien erscheint mir die Sache hier einfach: Wie groß wäre, einerseits, der Schaden für die Öffentlichkeit, wenn sie nicht erfahren dürfte, wer da verhaftet wurde oder warum genau? Und wie groß, andererseits, der Schaden für die Sängerin, wenn sie — möglicherweise zu unrecht — noch vor einer Anklageerhebung oder gar einer Verurteilung als skrupellose HIV-positive Schlampe dargestellt wird?
Die Öffentlichkeit gewinnt durch die Berichterstattung viel weniger, als die Beschuldigte verliert. Und die Information der Öffentlichkeit ließe sich auch nachträglich herstellen, zum Beispiel, wenn es tatsächlich zu einer Verurteilung kommen sollte. Der Ruf der Frau hingegen lässt sich nachträglich kaum wieder kitten, wie nicht zuletzt der Fall des Andreas Türck zeigt.
Ich weiß nicht, ob der Kollege von der F.A.Z. gesehen hat, was „Bild“ am Mittwoch zur riesigen Schlagzeile gemacht hat. Am größten stand oben auf Seite eins: „[…]-Star […] HIV-positiv“. Das war die Nachricht. „Bild“ konnte dank einer mitteilungsfreudigen Staatsanwaltschaft der Nation diese Information übermitteln, die ganz sicher zur Intimsphäre eines Menschen gehört und die breite Öffentlichkeit nichts angeht — es sei denn, man wäre der Meinung, dass alle Namen von HIV-positiven Menschen veröffentlicht werden sollten, die im Verdacht stehen, ungeschützten Sex zu haben und ihre Partner über ihre Infektion nicht immer aufzuklären.
Wenn „Bild“ das Recht hatte zu verbreiten, dass die Sängerin HIV-positiv ist, bedeutet das, dass wir alle ein Recht hatten, das zu erfahren. Hatten wir das wirklich?
Die Konzentration auf die juristische Frage verengt die Diskussion ungemein. Es ist verführerisch bequem, sich allein mit dieser Frage zu beschäftigen, weil sie von der Verantwortung für das eigene Handeln ablenkt. Die Kette geht ja ungefähr so: Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, um wen es sich bei der Beschuldigten handelt, muss „Bild“ das auch schreiben dürfen. Und wenn „Bild“ das schreibt, müssen seriöse Medien das auch schreiben dürfen. Und wenn es schon überall steht, wäre es doch albern, es im eigenen Blog nicht auch zu wiederholen. Die Entscheidung eines einzigen Staatsanwaltes legitimiert die Berichterstattung der gesamten Medienlandschaft. Das Glied in der Kette mit den geringsten Skrupeln bestimmt, was überall zu lesen ist.
So utopisch das klingen mag: Dass der Staatsanwalt aufregende Details aus dem Intimleben einer Prominenten erzählt, heißt nicht, dass man sie veröffentlichen muss. Und dass ein gewissenloses Boulevardblatt sie veröffentlicht, heißt nicht, dass man sie als „Spiegel Online“, RTL oder F.A.Z. weiter verbreiten muss. Machen wir uns nicht vor, dass irgendjemand dabei zwischen öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsrecht abgewogen hätte. Die Abwägung findet statt zwischen mehr und weniger Auflage, Quote und Klicks.
Medien können sich doch bei der Entscheidung, was und wie sie berichten, nicht nur von der Frage leiten lassen, was erlaubt ist. Sie müssen sich die Frage stellen, was richtig ist. Und was notwendig ist. Ich weiß nicht, ob es erlaubt war, über den Verdacht gegen eine Sängerin, über ihr Intimleben und ihre HIV-Infektion zu berichten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es nicht notwendig war.