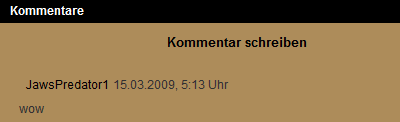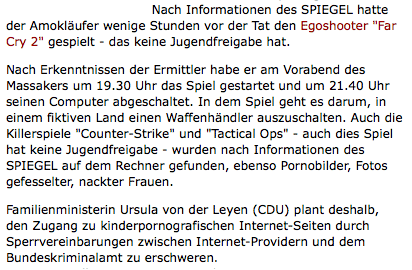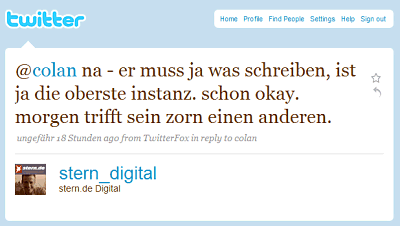Nach dem Amoklauf in Erfurt mussten sich die Medien noch fragen lassen, was denn ihre Verantwortung für solche Ereignisse sein könnte. Die Fernsehsender sollten sich sogar auf Wunsch von Bundeskanzler Gerhard Schröder um einen Runden Tisch zum Thema Gewalt in den Medien setzen.
Diese Zeiten sind vorbei. Denn es gibt ja jetzt das Internet, in dem jedermann selbst publizieren kann. Seit die professionellen Medien das Monopol auf die Veröffentlichung zweifelhafter, persönlichkeitsrechtsverletzender oder gefährlicher Inhalte verloren haben, können sie sich hemmungslos über die Veröffentlichung derselben zweifelhaften, persönlichkeitsverletzenden oder gefährlichen Inhalte durch andere empören. Wenn Laien das tun, ist das offenbar viel schlimmer.
Die Medien schaffen es, das sogenannte Mitmachnetz dafür verantwortlich zu machen, dass auf YouTube ein Video von den letzten Minuten des Amokläufers zu sehen ist, und dabei auszublenden, dass dieses Video von RTL exklusiv gekauft und verbreitet wurde. Sie schaffen es, sich darüber aufzuregen, dass auf Twitter das Haus der Familie des Amokläufers gezeigt wird, und dabei auszublenden, dass ihr eigenes Medium dieses Haus groß als Aufmacherbild zeigt.
Ich hatte das zunächst für die Deformation einzelner Kollegen gehalten. Inzwischen bin ich überzeugt: Das hat System. Journalisten nutzen das Internet, um die berechtigte Kritik an ihrem eigenen Vorgehen systematisch auf die Amateur-Publizisten zu projizieren. Womöglich hat das nicht nur eine strategische, sondern auch eine psychologische Komponente und hilft irgendwie, den unterschwelligen Selbsthass zu kompensieren.
Den vorläufigen Tiefpunkt bildet ein Artikel, den „Welt am Sonntag“-Chefredakteur Thomas Schmid am vergangenen Wochenende als Kulturaufmacher über den Amoklauf veröffentlicht hat. Er benutzt das Thema nicht nur, um, wie immer, gegen „linke [beliebiges Substantiv]“ zu wettern. Er benutzt es auch, um dem Web 2.0 eine Mitschuld zu geben.
Der Vorspann seines Artikels geht so:
Die Unsterblichkeit des Amok-Täters: Tim K. wusste wohl, dass er schon Stunden nach seiner Tat auf immer in die Hall of Fame des Verbrechens eingehen würde. Mit seiner Tat hat er die große Erzählung vom Amok weitergesponnen. Dass er das konnte, ist auch eine Folge von medialer Demokratisierung.
Schmid beschreibt geradezu verführerisch, wie attraktiv so ein Amoklauf in Zeiten der Massenmedien ist:
Mit ein paar Schüssen wird einer, der bisher ein gänzlich Unbekannter oder gar ein Gehänselter und Verlachter war, zu einem, der schon zwei Stunden nach den ersten Schüssen auf allen Fernseh- und Internetkanälen des Globus präsent ist. (…) Er betritt eine Hall of Fame, der er auf immer angehören wird, aus der niemand ihn vertreiben kann.
Nun könnte man schon fragen, ob das angemessene Formulierungen angesichts der sehr realen Gefahr von Nachahmungtstätern ist. Und vor allem müsste man fragen, was die Medien dagegen tun könnten, auf diese Weise zu posthumen Werkzeugen der Mörder zu werden. Das müssten die Medien nicht zuletzt sich selbst fragen (der „Spiegel“ zum Beispiel, der dem Mörder gerade ein hübsches Titelbild-Denkmal gesetzt hat) — das müssen sie aber nicht mehr, denn es gibt ja den publizierenden Pöbel im Internet. Und genau dorthin biegt Thomas Schmid zum Finale seines Artikels ebenso konsequent wie unvermittelt ab:
Letztlich aber sind es nicht einmal, wie die linke Kulturkritik meint, „die“ Medien, die dem Täter zum Ruhm verhelfen. Es sind Krethi und Plethi, die das (oft mit medialer Hilfestellung) besorgen. Und das ist, wenn man will, ein Demokratisierungserfolg. Konnten früher medial nur die Privilegierten, also die journalistischen Fachleute, mithalten, hat das weltweite Netz, das alle mit allen verbinden kann, im Prinzip jeden Einzelnen zum Wirklichkeitsdeuter und -bildner gemacht. Dass Tim K. heute eine populäre, in der ganzen Welt bekannte Gestalt ist, ist auch eine Folge von user generated content.
In vielen digitalen Galerien wird die Tat von Tim K. aufbewahrt, wird die Erinnerung an ihn gepflegt werden. Seine Motive mögen die gleichen sein wie die eines Attentäters von 1907. Neu ist, dass man heute mit Taten wie diesen binnen Stunden den Laufsteg der Unsterblichkeit betreten (und sich von der Mühsal des Alltags verabschieden) kann. Vielleicht besitzt dieses Angebot, an dem Millionen von usern mitweben, eine metaphysische Anziehungskraft. Ist es vorstellbar, dieses wahrhaft massenmediale Angebot wieder zurückzuziehen?
Was für ein hanebüchener Unsinn: Nicht die Massenmedien verhelfen dem Täter zum verführerischen Ruhm, wenn sie in Millionenauflage über ihn berichten und einen nicht enden wollenden Strom von Bildern, Illustrationen, Videos, Fakten und Scheinfakten produzieren, sondern Krethi und Plethi (wie der „Pöbel“ offenbar mit Vornamen heißt), die dieses ganze Material dann verlinken, in ihr StudiVZ-Profil stellen und auf YouTube mit kitschiger Musik unterlegen?
So unverschämt ist das Heilsversprechen beim Kampf gegen die digitale Revolution selten formuliert worden: Wenn wir nur die Zahnpasta zurück in die Tube brächten und das Publizieren wieder den Profis überließen, könnte die Welt eine bessere sein. (Und den Journalisten ginge es auch besser.)
Um dieses Ablenkungsmanöver in all seiner dreisten Verlogenheit würdigen zu können, muss man allerdings sehen, wie der Artikel des „Welt am Sonntag“-Chefredakteurs in der Zeitung aufgemacht war.
So:

(Verpixelung von mir.)
Testfrage: Wen zeigt das große Foto neben den Worten „Die Unsterblichkeit des Amok-Täters“, das keinen weiteren Bildtext hat?
Nein, es zeigt nicht den „Amok-Täter“ Tim K. Der Junge auf dem großen Foto, den der unbefangene „Welt am Sonntag“-Leser für den Amokläufer halten muss, ist ein namenloser trauernder Junge bei einem Gottesdienst für die Opfer in Winnenden.
Diese Medien haben allen Grund, von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken.
[via „Medium Magazin“]