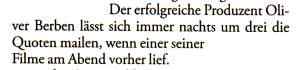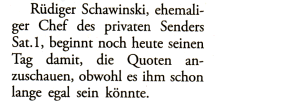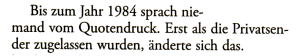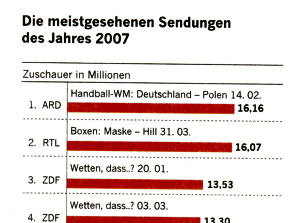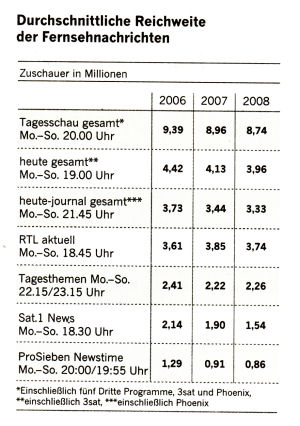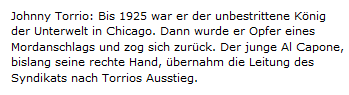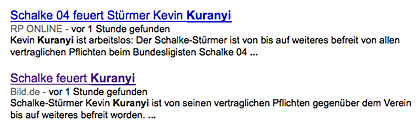Als Das Erste im November 2007 eine neue Show mit Frank Elstner namens „Das unglaubliche Quiz der Tiere“ startete, warb der Sender dafür nicht nur mit dem eigenen Moderator, sondern auch mit einem Mann von der Konkurrenz: Es sei der erste Auftritt von Günther Jauch als Kandidat in einer Quizshow.
Ein gutes Jahr später saß der RTL-Moderator wieder als Quiz-Kandidat in einer ARD-Show: Diesmal hieß sie „2008 – Das Quiz“ und wurde von Frank Plasberg moderiert.
Und was eint beide Sendungen? Sie werden von Jauchs Firma I&U produziert. Ein Sender, der sich eine Show von I&U produzieren lässt, bekommt als Bonus, wenn er mag, Jauch als Gast mit dazu. Das ist kein schlechter Deal: Jauchs Prominenz trug sicher mit dazu bei, dass beide Sendungen jeweils knapp sieben Millionen Zuschauer hatten, was viel ist.
Jauchs Gastauftritte helfen dem Sender – und ihm selbst als Produzenten. Der Markt der Fernsehproduzenten wird in Deutschland – auch deshalb – inzwischen im erstaunlichen Maß von Fernsehmoderatoren dominiert, und Jauchs Kollegen greifen zum Anschub einer neuen Sendung gerne auf denselben Trick zurück. ZDF-Moderator Johannes B. Kerner saß im vergangenen Dezember als Kandidat in der ARD-Show „Deutschlands größter Gedächtnistest“, die von seiner Firma Die Fernsehmacher für das Erste Programm hergestellt wurde. Und sogar ARD-Allesmoderierer Jörg Pilawa fand im November die Zeit, sich für die Premiere der ZDF-Show „Das will ich wissen“ als Gast zur Verfügung zu stellen. Produziert wurde sie von einer Firma namens White Balance. Deren Geschäftsführer heißt, richtig: Jörg Pilawa.
Mit diesem Hintergrundwissen können Sie nun sogar selbst erraten, wer in der Jury sitzen wird, wenn das ZDF in diesem Sommer in einer Art Casting-Show Nachwuchstalente sucht, die sich zutrauen, Bundeskanzler zu werden. Sie müssen dazu nicht einmal wissen, dass die Show „Ich kann Kanzler“ heißt (der schöne Alternativvorschlag „Ich will hier rein“ konnte sich leider nicht durchsetzen), dass sie von ZDF-Nachrichtenmann Steffen Seibert moderiert wird, dass sich Teilnehmer online mit Fotos, Videos und einer „Idee für Deutschland“ bewerben können und die Jury aus den 40 besten Bewerbern vier auswählt, die in einer Live-Show am 19. Juni gegeneinander antreten und um den Titel „Kanzler für einen Abend“, ein „Kanzlergehalt“ und ein Praktikum in Berlin kämpfen.
Alles, was sie wissen müssen, um auf die Lösung zu kommen, ist, dass das ZDF den Auftrag zur Produktion an Günther Jauchs Firma I&U vergeben hat.
Na?
Bingo!
Im Original der Show, das seit drei Jahren in Kanada als „The Next Great Prime Minister“ läuft, sind es ehemalige Premierminister, die in der Jury über die Bewerber entscheiden. Aber Günther Jauch, den die Deutschen in Umfragen regelmäßig als ihren Wunsch-Bundeskanzler angeben, ist für das ZDF natürlich auch ein Coup. Quasi als bester Bundeskanzler, den wir nie hatten.