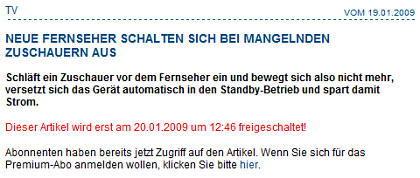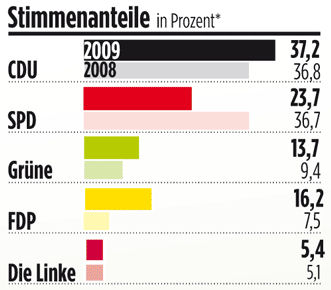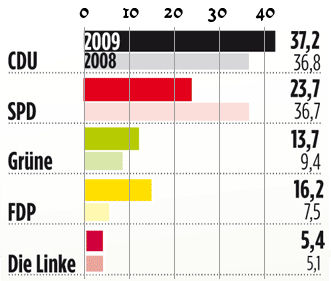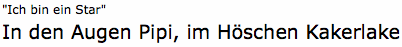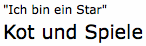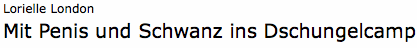Ein Fluch liegt auf dem deutschen Fernsehen, der Terror der naheliegendsten musikalischen Untermalung. Egal ob ein Bauer seine Frau sucht, ein Restaurant seinen Rach oder ein Auswanderer sein Glück – unter jeder Szene liegt ein Musiktitel, der das Geschehen oder die aktuelle Stimmung doppelt. Die Auswahl scheint sich auf eine Doppel-CD mit den größten Hits der 80er und 90er zu beschränken (plus „Viva la Vida“ von Coldplay). Fast immer handelt es sich um die naheliegendste Idee oder den ersten Treffer bei der Titelsuche. Keine Kornfeld-Szene ohne Jürgen Drews; wenn jemand sagt, dass ihm etwas egal ist, kommt Shakespeare’s Sister mit „I Don’t Care“, und wenn Hilfe naht, naht sie nicht ohne die Beatles und „Help!“ Manchmal ist die Textzeile, die das Gesehene exakt wiederholt, sogar nur für drei Sekunden zu hören.
Zu den unterschätzten Qualitäten von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ gehört es, anders mit Musik umzugehen. Zum Abschluss der letzten Staffel, als die Kandidaten das Camp verließen, in der vagen Hoffnung, ihrer Karriere neues Leben eingehaucht zu haben, und mit der realistischen Aussicht, ihr den endgültigen Todesstoß versetzt zu haben, war „Vielleicht“ von den deutschen Indierockern Madsen zu hören: „Vielleicht ist das der Anfang / Vielleicht ist das das Ende…“
Wenn Giulia Siegel Peter Bond zärtlich im Teich wäscht, liegt „Underwater Love“ von Smoke City darunter. Und das intime Gespräch zweier Männer am Lagerfeuer wird vom Soundtrack zu „Brokeback Mountain“ begleitet.
Die Titel sind oft hintergründige Kommentare zum Gezeigten – und die Interpretenliste kann sich sehen lassen: Am Dienstag untermalten die Smashing Pumpkins, The Verve, Sigur Rós, Feist, Babyshambles, Justin Timberlake, Air, Amy MacDonald und die Dust Brothers das Geschehen im Dschungel.
Anlass für einen Anruf in Australien: bei Markus Küttner, 37, dem Ressortleiter Comedyshow bei RTL.
Das Fernsehblog: Sind Sie der Mann, der die Musik für die Dschungelshow aussucht?
Markus Küttner: Nicht jede Musik für jede Sendung, das sind ja hundert Titel. Aber ich sorge schon dafür, dass wir nicht zu jedem Sonnenaufgang „Morning has broken“ spielen, dass nicht immer „Money“ von Pink Floyd zu hören ist, wenn über Geld geredet wird, und nicht die Miss-Marple-Musik kommt, wenn eine alte Frau durchs Bild geht.
Das heißt, es gibt eine bewusste Vorgabe von RTL, es anders zu machen als in der typischen Doku-Soap?
Das ist eine Vorgabe von mir.
Manchmal entscheiden Sie sich aber auch für die naheliegendste musikalische Illustration. Wenn die Österreicherin „Mausi“ Lugner ins Bild kommt, erklingt zum Beispiel „Der dritte Mann“ oder Falcos „Vienna Calling“.
Die Producer, die den Film geschnitten haben, als Mausi auf der Dachterasse im Hotel erscheint, hatten ursprünglich Wiener Walzer darunter gelegt – das war mir doch eine Nummer zu hart. „Vienna Calling“ war dann der kurzfristige Ersatz – das fand ich noch ganz okay.
Wie läuft das ab bei der Produktion?
Die Producer sitzen hier in Australien ganz normal an Schnittprogrammen wie sonst auch – nur wenn man hier vor die Tür geht, ist nicht ein trauriges Industriegebiet, sondern Dschungel. Die Producer arbeiten dann ziemlich unabhängig und legen unter den Rohschnitt schon Musikvorschläge. Inzwischen wissen alle, in welche Richtung wir da gehen wollen – da schlägt keiner mehr „Money“ vor.
Haben Sie eine ganze Digital-Bibliothek dabei? Oder haben Sie Hundert CDs in den Dschungel mitgenommen?
Das haben wir tatsächlich bei den ersten beiden Staffeln gemacht. Das Internet hier war damals noch sehr langsam, und wenn man morgens um sechs eine Livesendung hat und um vier anfängt, bei iTunes einen Song runterzuladen und es nur millimeterweise vorwärts geht – dann wird man wahnsinnig. Ich habe mein iTunes komplett mitgenommen, was schon mal ganz gut ist, und viele Producer haben ihre Sammlungen mitgebracht. Wir kaufen aber auch viel spontan. Gerade für die Eröffnungssequenz, vor der Begrüßung durch Sonja und Dirk, da liegen ziemlich bombastische Titel drunter. Da ist oft auch Filmmusik drauf, die man nicht unbedingt parat hat.
Zum Einzug, als alle sich zum ersten Mal in dem Lageplatz mit dem Teich umsahen, war Peter Fox zu hören mit „Haus am See“ – allerdings nur der Instrumentalteil. Solche Anspielungen funktionieren also nur für Leute, die das Lied kennen. Was ist die Idee dahinter?
Zunächst einmal hat die Musik gut zu der Szene gepasst. Selbst wenn das Stück einen ganz anderen Text gehabt hätte, hätte die Musik alleine trotzdem gepasst. Das ist natürlich die Hauptsache. Aber wenn man noch einen kleinen Insider-Gruß für, ich weiß nicht, fünfzehn Prozent unserer Zuschauer mit hineinpacken kann, die es erkennen und sich freuen: um so besser. Die ganze Show ist vielschichtiger als ein Großteil derer, die darüber berichten, überhaupt erkennen. Es steckt viel mehr drin.
Als Giulia Siegel klagte, dass sie ohne eine aufgestockte Zigarettenration nicht im Dschungel bleiben könnte, lief „Better Living Through Chemistry“ von Queens Of The Stone Age.
Ja. Und in der letzten Staffel hatten wir Julia Biedermann, die gleichzeitig im „Playboy“ mit Hochglanzbildern war und im Camp aussah wie Rod Stewart nach einer durchsoffenen Nacht. Darunter haben wir von den Sternen „Was hat dich bloß so ruiniert“ gelegt – lustigerweise auch erst nur das Intro, ohne Text. Wir haben auch gerne mal schöne Intros von Radiohead, allerdings eher die älteren Sachen. Die neuen sind selbst für abgefahrenere Shows ein bisschen zu hart.
Ist es eine bewusste Entscheidung, so stark auf für RTL untypische Musikfarben zu setzen?
Ich weiß nicht, ob die Musikfarben wirklich so untypisch für RTL sind. Ich bin zum Beispiel auch für die Doku-Soap „Teenager außer Kontrolle“ zuständig. Da nehme ich nicht so viel Einfluss und wir haben mehr Filmmusiken, aber das geht in eine ähnliche Richtung. Auch bei der „Super-Nanny“. Ich bin seit Jahren großer Radiohead-Fan, und immer wenn Radiohead in der Show zu hören ist, bekomme ich innerhalb von drei Minuten 15 SMS von Freunden, die sagen: Du Idiot, was spielt ihr Radiohead im RTL-Programm?!
Schöne Situation: Sie müssen sich vor RTL rechtfertigen, dass sie Radiohead spielen, und vor den Radiohead-Fans, dass sie es bei RTL spielen? Sie machen beiden das Programm kaputt!
Vielleicht bringe ich da Welten zusammen, die in Wahrheit zusammen gehören… Nein, das macht einfach Spaß, und am Ende geht es immer um die Sendung.
Haben Sie, so weit weg von der Zentrale, mehr Freiheiten als sonst?
Freiheit habe ich sonst auch. Aber hier im Dschungel gibt es nur wenige Stellen mit Handyempfang. Da ist man nicht immer erreichbar, das kann schon mal praktisch sein. Wir haben uns in früheren Staffeln zum Beispiel über die wunderbaren Dschungelsongs lustig gemacht. Soviel Selbstironie muss erlaubt sein, schließlich machen Sonja und Dirk bei ihren Sprüchen auch vor sich selbst nicht halt.
Und trotzdem hatten sie den schrecklichen aktuellen Song, die Zipfelbuben mit „Hier im Dschungel“ neulich in die Sendung eingebaut.
Ach, das passiert.
Dann ist RTL Enterprises glücklich?
Ja. Aber der eigentliche Kampf als Programmverantwortlicher beginnt eher jetzt, wenn die Single im Handel erhältlich ist und Promo dafür gemacht wird. Ich wehre mich natürlich nicht grundsätzlich dagegen, aber so, wie Sonja und Dirk die Sendung moderieren, würde es nicht passen, das in der üblichen Manier zu tun.
Warum ist es so schwer, in anderen Shows auch so ambitioniert und überraschend bei der Musikauswahl zu sein? Ist es wirklich so, dass die Zuschauer eigentlich nur den Wiedererkennungseffekt wollen, dass in jeder Szene genau die Textzeile kommt, die sie kennen und die das Geschehen eins-zu-eins illustriert?
Tatsache ist, dass beides funktioniert. Es funktioniert der typische Doku-Soap-Stil genauso wie unser eher abwechselungsreiches Konzept. Es gibt eine Berechtigung für beides.
Darf ich mir noch was wünschen?
Klar.
Echt?
Na, ich habe ja nicht gesagt, dass ich Ihren Wunsch erfülle.
(Aber was läuft am Abend, in Folge 7, nach 14 Minuten, wenn sich die Kandidaten auf ein unerwartetes Belohnungsfrühstück mit Toast und Marmelade stürzen? „When Will I Ever Get Home“ von den Kilians!)