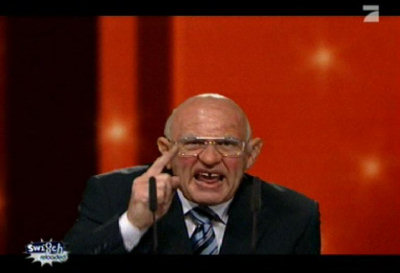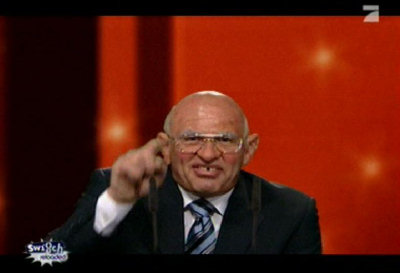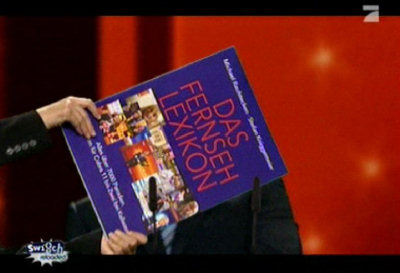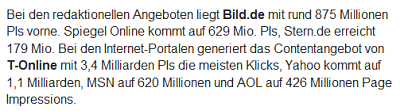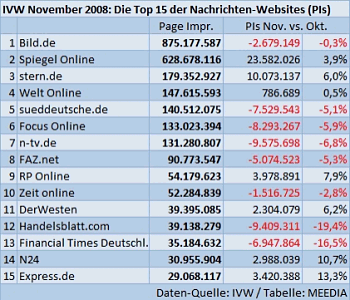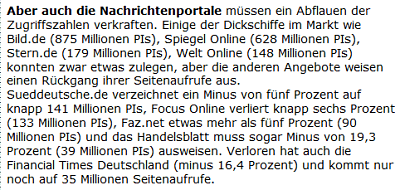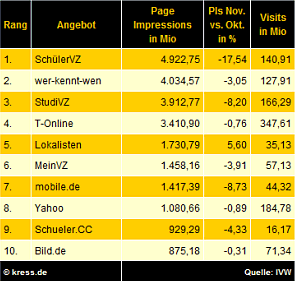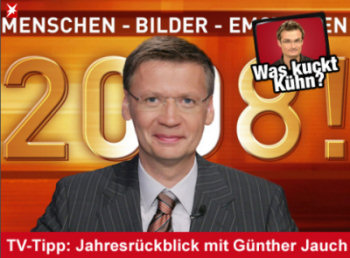Eine illustre Gesellschaft: Die Rassisten von „Politically Incorrect“, die sich für Christen haltenden Hassprediger von „Kreuz.net“, die rechtskonservativen Publizisten der „Jungen Freiheit“ und diverse evangelikale Gruppen empören sich, dass in der Zeitung „Q-rage“, die mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in hunderttausendfacher Auflage an den Schulen verteilt wird, ein kritischer Artikel über evangelikale Christen und das umstrittene „Christival“ steht.
Als Hauptfigur diente den Autoren, zwei 18-jährigen Schülern, die 19-jährige Leonie:
„Mir ging es damals nicht gut, Stress in der Schule, Stress zu Hause, wie eine Verdurstende habe ich mich nach Gemeinschaft gesehnt.“ Leonie hat den Weg aus der Verwirrung in eine Gemeinschaft inzwischen gefunden. Die 19-Jährige ist den „Weg zu Gott“ gegangen, wie sie es in ihrem Profil preisgibt. Heute steht nicht mehr sie im Mittelpunkt ihres Lebens, sondern Jesus.
Der Artikel endet so:
Der Mensch hat ein Bedürfnis nach einfachen Antworten. Die Religionen geben sie. Leonie findet, die Juden müssten als Erstes missioniert werden. Homosexualität hält sie für eine Krankheit, Abtreibung für ein Verbrechen. Leonie sagt, es geht ihr gut.
Es ist ein Text, der keinen Zweifel lässt an der Haltung der Autoren — aber Haltung ist ja genau das, was die Aktion „Schule ohne Rassismus“, die hinter der Zeitung steht, propagieren will. Die Evangelikalen aber fühlen sich verunglimpft und regen sich sogar über alltäglich-ironische Formulierungen wie die auf, die fast 20.000 christlichen Jugendlichen hätten Bremen vier Tage lang „unsicher gemacht“.
Was die Kritiker von rechts darüber hinaus auf die Barrikaden bringt, ist ein Begleitbrief von Thomas Krüger, dem Präsidenten der bpb. Er empfahl die Publikation mit den Worten:
„In der Zeitung finden sich interessante Informationen, wie islamistische und evangelikale Gruppen, die wichtige Freiheitsrechte in Frage stellen, Jugendliche umwerben.“
Das war mindestens ungeschickt formuliert, weil die Funktion des Relativsatzes nicht eindeutig ist: Unterstellt Krüger allen islamistischen und evangelikalen Gruppen, wichtige Freiheitsrechte in Frage zu stellen (explikativer Relativsatz)? Oder spricht er nur von denjenigem Teil dieser Gruppen, die wichtige Freiheitsrechte in Frage stellen, ohne damit alle zu meinen (restriktiver Relativsatz)?
Wie die hypersensiblen und hyperaggressiven Evangelikalen und ihre Verbündeten den Satz verstanden haben, ist klar. Sie sehen in ihm (ebenso wie der erzkonservative Kollege von der „Welt“) zudem eine Gleichsetzung von Islamisten und Evangelikalen (und meinen dabei natürlich, dass die „Evangelikalen“ eine bunte Mischung von verschiedenen Gläubigen sind, die „Islamisten“ aber alle Terroristen).
Nun ist es das gute Recht dieser Gruppen, sich lautstark zu empören. Und es ist auch das gute Recht von Thomas Krüger, klarzustellen, was er sagen wollte, oder es sogar ganz zurückzunehmen. Was nicht geht, ist, was Krüger stattdessen gemacht hat: sich nachträglich von dem Artikel der beiden Schüler zu distanzieren. „Spiegel Online“ zitiert ihn mit den Worten:
„Die bpb hält diesen Beitrag in seiner Einseitigkeit und Undifferenziertheit für gänzlich unakzeptabel. Ich bin sehr dafür, sich kontrovers mit Themen zu beschäftigen. Aber wir können keinen Schutzschirm aufspannen für Beiträge, die nicht unserer differenzierten Herangehensweise entsprechen.“
Was für eine erbärmliche, feige Reaktion. „Gänzlich unakzeptabel“? Dieser harmlose, pointierte Artikel ist gänzlich unakzeptabel? Was für Artikel wünscht sich die bpb von den Schülern? Welche Haltung möchte sie fördern? Und, vor allem, was für ein Vorbild gibt sie ab, wenn unter Druck nicht nur selbst nachgibt, sondern den Druck an andere weitergibt?
Es mag sein, dass die Position von Herrn Krüger kein Rückgrat erlaubt. Dass er die gleiche Haltungslosigkeit aber von Schülern fordert, ist ein Skandal.
Inzwischen hat auch das offenbar nach dem unvermeidlichen Parteiproporz besetzte Kuratorium der bpb sich von Krüger und dem Artikel der Schüler distanziert. Der Vorsitzende Ernst-Reinhard Beck (CDU) und sein Stellvertreter Dieter Grasedieck (SPD) erklärten: „Wir halten eine ausgewogene Darstellung politischer und gesellschaftlicher Sachverhalte für unbedingt notwendig.“ Vielleicht sollte „Q-rage“ dann gleich noch seinen Untertitel ändern. Von „Schule ohne Rassismus“ in „Rassismus in der Schule — Pro & Contra“.
Die aktuelle Ausgabe von „Q-rage“ (pdf) ist auf deren Homepage nicht mehr verfügbar. „Q-rage“ soll übrigens „Mut“ heißen.
Mehr bei „Spiegel Online“ und in der „taz“ (1, 2).