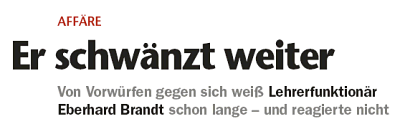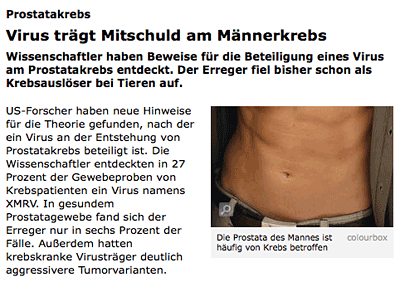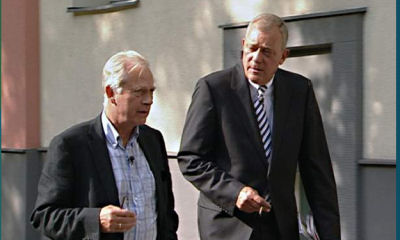War’s das?
Bald wird unser „Internet-Manifest“ vermutlich auch in den letzten südphilippinischen Regionaldialekt übersetzt und vom letzten amerikanischen Blogger retweetet worden sein, und nach über 400 Kommentaren versickert die Diskussion hier im Blog (und drüben beim ix) allmählich in Seitensträngen wie der Frage, ob Mercedes Bunz, die darüber beim „Guardian“ gebloggt hat, prominenter als nur in einer dezenten Vier-Wort-Klammer im dritten Absatz hätte darauf hinweisen müssen, dass sie selbst zu den Autoren gehört. Ich finde: ja. Aber ich finde auch: geschenkt.
Aber was passiert jetzt?
Wir haben darüber beim Zusammenfinden und beim Verfassen dieses Textes nie geredet. Wir haben ihn geschrieben, weil wir das Gefühl hatten, dass er geschrieben werden muss. Weil wir es nicht mehr ausgehalten haben, was die Verleger der Medien, für die wir oftmals arbeiten und auf die wir eigentlich auch in Zukunft nicht verzichten wollen, Woche für Woche für gefährlichen, himmelschreienden Unsinn über das Internet in die Welt posaunt haben.
Die erste Mail von Mario Sixtus, die alles anstieß, begann mit den Sätzen:
Liebe Leute, es reicht!
Ich glaube ich bin nicht der einzige, der mit seiner Geduld am Ende ist, was Verleger, Journalistengewerkschaftsschwafler, Kulturteildummschwätzer und ihre [Städtenamen]-Pamphlete in Sachen Internet angeht. Ich finde, wir müssen etwas tun. Was könnn Journalisten tun? Etwas schreiben. Yeah!
Kein Wunder, dass wir uns keine Gedanken über das Danach gemacht haben und wir über das Wozu gar nicht grübeln mussten. Wir wollten alle etwas sagen, und damit es auch wirklich gehört wird, wollten wir es gemeinsam sagen. Und wie das so ist, wenn man Sachen aufschreibt: Wenn man Glück hat, stoßen sie etwas an, lösen etwas aus, haben sichtbare oder unsichtbare Folgen. Und wenn man Pech hat, verpuffen sie irgendwie. Aber man kann eigentlich in den seltensten Fällen eine konkrete Wirkung einplanen oder gar die Gründung eines Verbandes (was für mich eine der abwegigeren Unterstellungen im Zusammenhang mit diesem Text war).
Es klingt nach einer Plattitüde, wenn ich auf die Frage, was wir mit diesem „Manifest“ eigentlich erreichen wollten, antworte: eine Diskussion anstoßen. Aber genau so ist es. Ich wollte versuchen — und ich glaube, den anderen ging es genau so — in der Debatte über die Zukunft des Journalismus einen Widerpart zu verankern, einen Punkt, auf den andere sich beziehen können, wenn wieder einmal von Lobbyisten irgendeine Erklärung in irgendeiner Stadt verabschiedet wird, in der sie zur Rettung des Publizierens auf Papier auffordern statt zur Rettung des Journalismus. Wenn wieder einmal jemand das Internet auf Diebe, Rufmörder, Kinderschänder reduziert. Wenn wieder einmal jemand glaubt, dass man an dem Medium, in dem ein Text veröffentlicht wird, seine Qualität ablesen kann.
Was wir wirklich schlecht gemacht haben beim Veröffentlichen unseres „Manifestes“: seinen Adressaten zu nennen. Es muss bizarr wirken auf Menschen, die in diesem Medium in einem ganz anderen Maße zuhause sind als ich, wenn da plötzlich 15 Berufs-Publizisten ankommen und ihnen erklären wollen, wie das Internet funktioniert. Vielleicht erklärt sich ein Teil der Ablehnung, den dieser Text gerade bei eingefleischten Onlinern erfahren hat, aus dieser wahrgenommenen Anmaßung, die von uns nie beabsichtigt war.
Natürlich ist unser „Manifest“ auch anmaßend (und mit dem Wort fängt es schon an), natürlich kommt es in vielen Punkten relativ breitbeinig daher, aber einem ganz anderen Ansprechpartner gegenüber: Denjenigen, die das Internet immer noch bekämpfen oder glauben, es gehe weg, wenn man es nur angestrengt genug ignoriert. Denjenigen, die es für eine Phase halten, einen Hype, der vorübergehen wird. Denjenigen, die glauben, ein solch revolutionäres Medium würde nichts ändern, sie müssten sich nicht ändern, und wenn überhaupt, müsste sich das Netz gefälligst ihnen anpassen und nicht umgekehrt, denn sie sind doch die Verleger, die jahrzehntelang den Menschen gesagt haben, was die Menschen wissen müssen, und das waren gute Zeiten für sie und für die Menschen und für die Demokratie, also vor allem: für sie.
Unsere Arroganz ist auch eine Art Notwehr, eine Reaktion auf die maßlose Selbstüberschätzung dieser Leute, die glauben, dass das, was sie tun, gut ist und unverzichtbar, weil sie es tun, und nicht, weil es gut und unverzichtbar ist. Die glauben, einen Anspruch darauf zu haben, mindestens so viel Geld zu verdienen im Internet wie Google, weil sie ja tolle und wichtige Inhalte ins Internet stellen und Google nur dafür sorgt, dass Leute sie auch finden. Die immer noch glauben, dass sich diese ganze Internetwelt um sie drehen müsse, und nicht gemerkt haben, dass sie ihre Wichtigkeit, Notwendigkeit, Verlässlichkeit plötzlich jeden Tag neu beweisen müssen, weil sie ein Monopol verloren haben und die Zeiten vorbei sind, in denen Menschen eine Zeitung lasen vom Abitur bis zur Rente. Die es erreicht haben, dass der „Beauftragte für Kultur und Medien“ der Bundesregierung, ein trauriger Mensch namens Bernd Neumann, eine „Nationale Intiative Printmedien“ gegründet hat und keine „Nationale Initiative Qualitätsjournalismus“. Die allen Ernstes fordern, dass ihre Zeitungen und Zeitschriften, darunter auch die ganzen Lügen-, Quatsch- und Wichsblätter, steuerlich günstiger gestellt werden als das tägliche Brot.
Wir sind nicht die Gegner der guten etablierten Medien, im Gegenteil. Wir schreien auf, weil wir die Sorge haben, dass viele von ihnen ihre Zukunft verspielen, wenn sie glauben, die Leser müssten zu ihnen kommen und nicht sie zu den Lesern. Wir sorgen uns um diese Medien, aus ganz eigennützigen Gründen, weil wir für sie arbeiten, und aus ganz anders eigennützigen Gründen, weil wir glauben, dass eine Gesellschaft auch in Zukunft guten Journalismus braucht.
Ich weiß, dass das jetzt merkwürdig pathethisch und eitel klingen mag, aber: Wenn ich tagein tagaus in diesem Blog die Medien kritisiere, dann tue ich das nicht, um Argumente gegen die Existenzberechtigung und Notwendigkeit dieser Medien zu sammeln, sondern im Gegenteil: Weil ich glaube, dass wir dringend Journalisten brauchen, die uns so wahrhaftig und transparent wie möglich informieren über das, was in der Welt passiert. Und weil ich es unerträglich finde, dass die Helmut Markworts dieser Welt ganz andere Prioritäten haben als die wahrheitsgemäße Information seiner Leser, nämlich nur ihre verdammten eigenen Interessen. Und weil ich es nicht glauben kann, dass die Medien, jetzt wo sie Konkurrenz von Amateuren bekommen haben, ausgerechnet an dem sparen, was sie von diesen unterscheidet. Und weil es mich wütend macht, wenn in vielen Online-Redaktionen keine Journalisten mehr sitzen, sondern Tratschweiber, Abschreiber und Klickstreckenbauer.
Ich finde es schlimm, wie viele Kommentatoren im Internet die Probleme des professionellen Journalismus bejubeln und glauben, es könnte eine blühende Zukunft ohne ihn geben. Aber ich kann das nicht den Kommentatoren vorwerfen — den Beweis für seine Relevanz und Zuverlässigkeit muss der Journalismus schon selbst bringen. Auch und gerade online. Patricia Riekel, die Chefredakteurin der „Bunten“, wird von der Fachzeitschrift „Horizont“ mit den Worten zitiert, sie glaube nicht, dass Journalisten „gleichzeitg [sic!] für Online und eine Zeitschrift arbeiten können. Geschichten in der ‚Bunten‘ verlangen Spitzenschreiber“. Das sind die Äußerungen, das sind die Leute, gegen die ich unser „Manifest“ setzen möchte: Leute, die suggerieren, dass man online keine „Spitzenschreiber“ braucht, dass online nur eine gewaltige Müllhalde ist mit merkwürdigen Leuten, die merkwürdige Parteien wählen und Kinderpornographie verteidigen.
Die Leute, die uns vorwerfen, nur Allbekanntes und Banales wichtigtuerisch in Thesenform gebracht zu haben, übersehen die Realität des Online-Journalismus in Deutschland. Natürlich ist es lächerlich, im Jahr 2009 zu schreiben: „Das Netz verlangt nach Vernetzung.“ Aber wie viele Online-Medien in Deutschland, die über einen Bericht, ein Interview in einem anderen Medium schreiben, setzen den Link zu dieser Quelle?
Natürlich ist es banal, im Jahr 2009 zu schreiben, „das Internet macht es möglich, direkt mit den Menschen zu kommunizieren, die man einst Leser, Zuhörer oder Zuschauer nannte – und ihr Wissen zu nutzen“. Aber wie viele Medien tun das tatsächlich? Bei sueddeutsche.de werden, trotz gegenteiliger Ankündigungen, bis heute noch jeden Abend um 19 Uhr die Kommentarbürgersteige hochgeklappt. Natürlich ist es ein Witz, im Jahr 2009 die These „Was im Netz ist, bleibt im Netz“ in ein bedeutungsschwangeres Papier zu schreiben. Aber bis heute glauben viele Journalisten, das Internet sei ein „flüchtiges Medium“ und könne entsprechend behandelt werden, während es in Wahrheit für den Normalbürger die gedruckte Zeitung ist, die schon einen Tag später nicht mehr aufzutreiben ist, während der Online-Artikel (mit all seinen Tippfehlern und unrecherchierten Inhalten) immer noch abrufbar ist.
Also: Ja, unser „Manifest“ steckt voller Selbstverständlichkeiten, von denen ich wünschte, sie wären wirklich selbstverständlich.
Es gibt eine konträre Kritik an dem Text, nämlich die, dass unsere Thesen verdammt steil sind. Die kann ich besser nachvollziehen. Ich habe mir – mit tatkräftiger Unterstützung der Feuilletonkollegen um Claudius Seidl, bei denen sowas gar nicht gut ankam – erst vor wenigen Jahren meinen viele Jahre gepflegten Kulturpessimismus abgewöhnt, und manche optimistische „Behauptungen“, die wir da aufstellen, gehen an die Grenzen dessen, was ich glaube.
Ich habe sie dennoch unterschrieben, weil ich glaube, dass eine mögliche Übertreibung in positiver Sicht ein notwendiger Ausgleich zu all den Untergangspropheten ist, die die unendlichen Chancen, die mit dem neuen Medium verbunden sind, nicht sehen wollen. Ich bestreite gar nicht, dass das Internet mit seinen Freiheiten und Möglichkeiten der Anonymität auch das Schlechteste in Menschen hervorbringt, aber das festzustellen, hilft nichts. Es hilft nur, das Internet zu umarmen und all das Gute, das es ermöglicht, heraus zu holen, und das ist unendlich viel. Natürlich kann an aufzählen, was für Mängel ein Angebot wie die Wikipedia hat. Aber dann nimmt man vermutlich nicht wahr, wie viele Menschen aus rein altruistischen Motiven daran mitgewirkt haben. Ich sehe das ja täglich an den Dutzenden Hinweisen, die wir bei BILDblog bekommen: Die Leute kriegen im Zweifelsfall noch nicht einmal eine freundliche Absage, verdienen tun sie ohnehin nichts. Sie teilen uns Dinge mit, weil sie glauben, dass das eine gute Sache ist.
ix schreibt, ihm fehlt in unserem Text die Euphorie:
mehr will ich mich jetzt eigentlich nicht mit dem manifest auseinandersetzen. ich würde mich jetzt lieber wieder für das internet begeistern und an dem was das internet eigentlich ist berauschen: pures, überbordendes potenzial.
Das trifft mich besonders, denn genau aus diesem Grund habe ich (haben, glaube ich, wir) diesen Text veröffentlicht: Aus dem Gefühl, dass das Netz so viel ermöglicht, das bisher nicht möglich war.
Natürlich kann man lamentieren, dass das Geldverdienen (und womöglich sogar das Qualitätsjornalismusfinanzieren) in der analogen Zeit leichter war. Aber was bringt dieses Lamento, wenn diese Zeit einfach vorbei ist?
Schallplatten sind toll, und ich kann gut nachvollziehen, dass es Liebhaber gibt, die sie sammeln, und Spezialisten, die dieses Medium weiter pflegen, aber wollen wir Journalisten ernsthaft die Leute sein, die dafür kämpfen, die Schallplatte zu erhalten, wenn die CD erfunden wurde und Musik sich längst ganz ohne Datenträger vertreiben lässt? Wollen wir Pferdekutschenbetreiber sein, die staatliche Hilfe fordern, damit uns das schrecklich schnelle, stinkende Auto nicht das Geschäft kaputt macht?
Ich weiß nicht, ob Zeitungen und Zeitschriften aussterben werden, ich glaube es nicht und hoffe es auch nicht — ich liebe Zeitungen. Aber man muss schon sehr verblendet sein, wenn man glaubt, dass auch nach der Ankunft eines Mediums, das so viel schneller, vielfältiger, zugänglicher ist, das aufwändige Drucken und Verschicken von Papier die natürliche, die dominante Form der Informationsvermittlung bleiben wird.
Ich finde in Zeitungen wie der „FAZ“ (für die ich arbeite) und einigen anderen immer wieder herausragende Texte, was kein Zufall ist, weil sie von Menschen geschrieben werden, die dafür ausgebildet wurden und dafür gut bezahlt werden, weil sie von anderen redigiert wurden, weil sie in einem Umfeld entstanden sind, das darauf angelegt ist, beste Bedingungen für die Produktion guter Texte zu schaffen. Die Zeitungen müssen alles dafür tun, diese Qualitäten zu bewahren.
Aber das wird nicht reichen. Sie müssen es schaffen, diese Qualitäten ins Internet zu bringen, dorthin, wo schon heute die jungen Leute sind, und in Zukunft ungefähr alle.
Schon wahr: Die Frage, wie Qualitätsjournalismus im Internet finanziert werden kann, ist noch nicht umfassend beantwortet. Aber daraus zu schließen, dass Qualitätsjournalismus im Internet nicht finanziert werden kann, ist falsch. Ein Grund, warum „Spiegel Online“ eine so dominante Position in Deutschland hat, ist der, dass man dort auch in schlechten Zeiten, als viele Konkurrenten ihr Internet-Angebot herunterfuhren, weiter investiert hat.
Nein, wir haben auch nicht für alle Herausforderungen und Probleme, die dieser Medienumbruch gerade mit sich bringt, konkrete Lösungen, und vermutlich hätten die 15 sehr unterschiedlichen Autoren, die an dem „Manifest“ mitgewirkt haben, auch sehr unterschiedliche Lösungsvorschläge. Wir haben kein 17-Punkte-Programm zur Lösung der Medienkrise vorgelegt.
Es ging mir (und ich nehme an: uns) nicht zuletzt um eine Haltung. Um die Forderung an die Verleger, Lobbyisten, Politiker, zu sehen, wie anders das Internet ist und was es alles verändert, und sich darauf ernsthaft einzulassen. Das klingt furchtbar banal und ist total revolutionär. Und es ging uns darum, ein paar Pflöcke einzuschlagen (ein paar zentrale Eckpfeiler sozusagen, jaha), nein: Markierungen, an denen wir sagen: Hier geht es nicht weiter. Wir können nicht ernsthaft darüber diskutieren, dass man Menschen als Bestrafung für Urheberrechtsverletzungen das Recht entziehen will, online zu gehen, wir können nicht ernsthaft darüber diskutieren, dass Links und Zitate genehmigungs- oder kostenpflichtig sein müssen, und so weiter.
Ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Die Frage war: Was passiert jetzt?
Die Antwort liegt doch auf der Hand: Jetzt reden wir drüber. Es ist ein merkwürdiger Vorwurf, der uns gemacht wurde, dass wir mit dem fertigen „Manifest“ an die Öffentlichkeit gegangen seien anstatt vorher das kollaborativ mit allen Interessierten zu entwickeln. Erstens zeigt sich, dass schon 15 Leute eher zu viele als zu wenige sind, um gemeinsam und ohne Hierarchien einen pointierten Text zu entwickeln. Und zweitens ist dieser Text nicht in Stein gemeißelt oder an irgendwelche Kirchentüren geschlagen, sondern er lebt im Internet. Er kann sich weiter entwickeln (man kann sogar peinliche Stilblüten aus ihm streichen), es kann durch die Beteiligung vieler Leute und konstruktive Kritik etwas Neues, Größeres, Besseres daraus werden — und man kann ihn nehmen, um sich an ihm zu reiben und Gegenentwürfe, Parodien, Verrisse zu formulieren.
Und wir? Wir müssen das nur ernst nehmen, was wir selbst geschrieben haben: „Nicht der besserwissende, sondern der kommunizierende und hinterfragende Journalist ist gefragt.“ Von den „sozialen Grundfunktionen der Kommunikation“ haben wir gesprochen: „Zuhören und Reagieren, auch bekannt als Dialog.“ Ich gebe zu, dass wir darin selbst nicht besonders gut waren in den vergangenen Tagen, und ich finde es auch ein bisschen peinlich, dass es so aussieht, als sei uns die weltweite Verbreitung des Textes wichtiger als die Diskussion hier.
Aber das kann sich ja ändern. Und auch das ist doch eine gute Sache an so einem Text: Wir müssen uns jetzt daran messen lassen.
Übrigens ist das Wort „Behauptungen“ im Titel des „Manifests“ kein kokettes Understatement, sondern nicht anderes als die Aufforderung, sich mit Widersprüchen und Belegen daran abzuarbeiten. Ich will gerne dazu beitragen und in Zukunft noch mehr als bisher über über die konkreten Fragen diskutieren, die sich aus den sich ändernden Bedingungen ergeben, unter denen sich Journalismus bewähren muss.
Kurz gesagt: Das „Internet-Manifest“ soll nicht das Ende der Debatte sein, sondern ihr Anfang. Auf meine Fragen zur Hamburger (Bankrott-)Erklärung der Verlage habe ich übrigens von den Papier-Lobbyisten des Zeitschriftenverleger-Verband VDZ bis heute keine Antwort bekommen.
- Morgen diskutiere ich ab 14.05 Uhr in der Sendung „Breitband“ im Deutschlandradio Kultur mit Jörg Wittkewitz über das Manifest (seine Kritik daran steht hier).
- Ebenfalls am Samstag widmet sich ab 18 Uhr auch die Sendung „Trackback“ auf Fritz dem Thema.