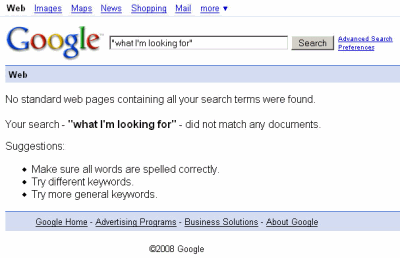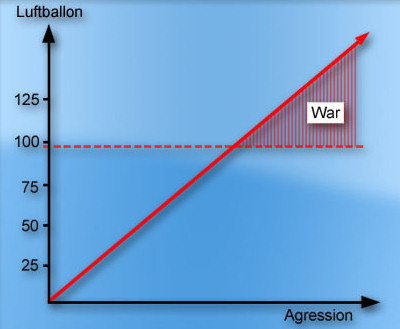… ist nicht mehr [Nachtrag: nur] Der Malte von Spreeblick, sondern Der Malte von malte-welding.de. (Die Idee mit der Adresse hat er sich total von mir abgeguckt, die Sau.) Jetzt muss er nur noch mal was Tolles bloggen, damit man mal einen Anlass hätte, darauf hinzuweisen.
Zoomer. Wir machen Werbung.

Gut, zumindest hat sich damit die Frage erledigt, ob das neue Nachrichtenjugendzukunftsgetöse Zoomer auf sowas wie journalistische Qualität setzt oder im Zweifelsfall doch lieber Promoplattform für Schwesterobjekte des Besitzers Holtzbrinck sein will. Hätte man sich dann nicht auch den demonstrativen Einsatz von Anstandsopa Ulrich Wickert sparen können? Oder braucht man ihn dann extra, so als Image-Ausgleich zum schmutzigen Alltag?
(Komischerweise nicht erwähnt in dem MeinVZ-Gegruschel von Zoomer wird das journalistisch zweifellos spannendste Thema des Tages rund um die VZ-Familie und ihr Bedürfnis, der Polizei zum Beispiel beim Identifizieren von Kiffern helfen zu können, als PR-Desaster sehr schön aufbereitet in zwei Teilen von Torsten Kleinz.)
Nachtrag, 28. Februar, 10.30 Uhr. Das MeinVZ-Stück ist von der Zoomer-Startseite verschwunden — obwohl es nach der Zoomer.de-Logik, die auf einer Mischung aus Aktualität und Leserinteresse bei der Platzierung von Themen beruht, dort stehen müsste. Offenbar kann man also auch von Hand in diesen angeblich automatisierten Ablauf eingreifen — vielleicht wenn einem ein Artikel im Nachhinein peinlich ist? Auch in der Übersicht der Top-Themen fehlt der Artikel.
Nachtrag, 12.30 Uhr. Zoomer-Chefredakteur Frank Syré schreibt in den Kommentaren:
das Stück ist kurzzeitig unten, weil es überarbeitet wird. Die kritische Anmerkung ist natürlich völlig richtig, das Bild ist völlig daneben und der Hinweis auf die Konzern-Verwandtschaft muss natürlich sein. Als Erklärung (entschuldigt den Fehler natürlich nicht): Da war gestern am späten Abend die Aufmerksamkeit weg. Wird grade angepasst.
Im Artikel selbst, der inzwischen auch wieder in der „Top-News“-Übersicht aufgetaucht ist, steht jetzt folgende Erklärung:
Liebe Leser,
da haben wir etwas verbockt: In der ersten Version dieses Beitrags haben wir nicht darauf verwiesen, dass MeinVZ — ebenso wie zoomer.de — zur Holtzbrinck-Gruppe gehört. Das macht man natürlich so. In den einschlägigen Blogs ist das prompt und zu Recht angeprangert worden. Wir sind uns darüber im klaren, dass unsere Berichterstattung über den neuen StudiVZ-Spross von der ein oder anderen Seite ins Reich der PR gerückt wird. Zugegeben: Der Verdacht drängt sich auf, sind wir doch verbandelt.
Anders als „Don Alphonso“ suggeriert, hat Zoomer die ersten, kritischen Kommentare der Leser nicht gelöscht. Sie sind nach wie vor online — aktuell allerdings nur auf der zweiten Seite des zweiseitigen Artikels. Dass die Kommentarfunktion gesperrt sei, wie auf der ersten Seite steht, ist wohl nur ein technisches Versehen.
Nachtrag, 12.45. Scheint ein hektischer Tag zu sein, heute in der Zoomer-Redaktion. Jetzt ist der Artikel nur noch auf einer Seite — dafür aber mit korrekt angedockten Kommentaren.
Springer 1968, im „Spiegel“ der Zeit
Springer-Blätter fälschen und unterdrücken Nachrichten. Das war das schlichte Urteil von Kai Hermann, als er im Frühling 1968 für die „Zeit“ untersuchte, wie „Bild“, „B.Z.“ und die anderen Zeitungen aus dem Hause Axel Springer über die Demonstrationen nach dem Attentat auf Rudi Dutschke berichteten.
Springer forderte daraufhin von der „Zeit“ eine Unterlassungserklärung. Die Wochenzeitung sollte sich verpflichten, nicht mehr zu behaupten:
- Die Berliner Springer-Zeitungen verfälschen die Wahrheit.
- Die Redakteure der meisten Springer-Blätter konnten das Fälschen nicht lassen.
- In den Berliner Springer-Zeitungen wurden Nachrichten unterdrückt.
Weil die „Zeit“ aber, wie der „Spiegel“ am 13. Mai 1968 gut gelaunt berichtete, gerne bereit war, „mit einer Fülle von Belegen“ diese Behauptungen nachzuweisen, sorgten sich die Rechtsvertreter Springers, dass das selbst beantragte Verfahren zum Springer-Tribunal würde. Plötzlich versuchten die Anwälte, das Thema von der Springer-Berichterstattung auf die Berichterstattung der Berliner Springer-Blätter zu Ostern zu reduzieren. Und Otto Köhler schrieb im „Spiegel“:
Doch auch die verzweifelte Selbstbeschränkung nützte dem Verlagshaus Springer nichts. Denn selbst die Beweismittel, die [Springers Anwalt] Arning dafür anbot, daß die Springer-Zeitungen wenigstens zu Ostern nicht gefälscht hätten, erschienen dem Gericht zu dürftig.
Ein Beispiel: Kai Hermann hatte es als „Falschmeldung“ bezeichnet, daß „Bild“ als einzige Zeitung der Bundesrepublik einen Gladbecker Möbelhausbrand mit der Suggestivschlagzeile „Ist das Demonstration? Ist das Diskussion? Möbelhaus in Brand gesteckt“ oppositionellen Studenten zur Last legte.
Um zu beweisen, daß „Bild“ hier nicht gefälscht habe, legte Arning dem Gericht eine dpa-Meldung vor. Doch der Hinweis auf studentische Beteiligung lautete: „Möglicherweise in Zusammenhang mit den Demonstrationen der letzten Tage steht ein Großbrand am Ostersonntag.“ Das reichte, um mit „Bild“-Balken-Zeilen in der ganzen Bundesrepublik Demonstranten zu Möbelhausanzündern zu machen.
Das Gericht gab der „Zeit“ weitgehend Recht und entschied, dass man einstweilig behaupten dürfe, dass die Berliner Springer-Blätter die Wahrheit verfälschen und ihre Redakteure das Fälschen nicht lassen können. Die „Zeit“ hätte allerdings nicht behaupten dürfen, dass „in Berliner Springer-Zeitungen Nachrichten von Übergriffen und Brutalitäten auf seiten der Polizei konsequent unterdrückt werden“. Denn wie der „Spiegel“ süffisant hinzufügte:
Konsequent nicht. Da auch Springer-Redakteure Menschen sind, geht ihnen solch eine Nachricht manchmal durch.
Was für Zeiten das waren! Was für Zeiten das waren, kann man wunderbarerweise jetzt selbst nachlesen; geschildert nicht nur aus dem Rückblick der Historiker, sondern aus Zeugnissen der damaligen Gegenwart: In den „Spiegel“-Artikeln von damals, die mit dem ganzen Archiv seit kurzem kostenlos zugänglich sind.
Kaum eine Woche verging im Jahr 1968, in der sich der „Spiegel“ nicht an Axel Springer und seinem Imperium abarbeitete. Manchmal genügte es, einfach unkommentiert ein Gerichtsurteil abzudrucken, wie die bemerkenswerte Entscheidung des Amtsgerichtes Esslingen, das es am 22. Oktober 1968 ablehnte, ein Hauptverfahren wegen Nötigung gegen einen Anti-Springer-Demonstranten zu eröffnen. Der 25-Jährige hatte vor der Ausfahrt eines Esslinger Verlages geparkt, um die Auslieferung der „Bild-Zeitung“ verzögern zu helfen. Und das Gericht argumentierte:
(…) Der Verleger Axel Cäsar Springer beherrscht einen Großteil des deutschen Zeitungsmarktes. Diese Machtstellung wird bei der öffentlichen Meinungsbildung wie auch im wirtschaftlichen Leben rigoros ausgenutzt … Die Springer-Zeitungen sind außerdem Musterbeispiele publizistischer Verantwortungslosigkeit. Es wird nicht objektiv berichtet — viele Richter wissen das aufgrund der falschen Gerichtsberichte über eigene Verhandlungen (auch in Esslingen sind konkrete Fälle bekannt) –, sondern aus Stimmungsmache, oder um einen Knüller zu haben, die Wahrheit gebogen, ja, es wird effektiv gelogen.
So wird im nichtpolitischen Sektor wahrheitswidriger, gefühlsbetonter Klatsch gemacht; im politischen Sektor, wo nicht so leicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterschieden werden kann, wird zumindest die Kritik eliminiert und nur eine bestimmte Meinung gemacht. Was dies bei der Verbreitung insbesondere der „Bild-Zeitung“ bei der einfacheren Bevölkerung bedeutet, bedarf keiner Erörterung.
(…) Auch die politisch engagierten Studenten erkannten die Gefahr für unsere Demokratie durch die Konzentration und die Gleichschaltung der Presse und vertraten mehrfach diese Meinung, speziell im Hinblick auf die Springer-Presse.
Diese unbequemen Studenten wurden hierauf von der Springer-Presse in einen Topf geworfen mit Gammlern und Halbstarken und als Radaubrüder qualifiziert … Die politischen Ansichten dieser Studenten mögen radikal, ja revolutionär sein; in einer freiheitlichen Demokratie sollte eine freie Presse aber objektiver darüber berichten. Wenn „Bild“ am 7. 2. 1968 schreibt: „Man darf über das, was zur Zeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und man darf auch nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen“, so ist dies nicht eine demokratische Auseinandersetzung mit einem Andersdenkenden, sondern üble Stimmungsmache und Aufhetzung zu Gewalttaten (§ 130 StGB!).
Vor diesem Hintergrund ist die Meinung, der Mordanschlag auf Rudi Dutschke sei ein mittelbarer Erfolg der durch die Springer-Presse gegen die radikalen Studenten aufgewiegelten und manipulierten Öffentlichkeit, zumindest verständlich. (…)
Auf fast zwei Seiten dokumentierte der „Spiegel“ nach den Oster-Unruhen überwiegend kritische Stimmen über Springer — darunter dieses wunderbare Zitat aus der „Bayerischen Staatszeitung“ vom 19. April 1968:
Zahlreiche Analysen des Inhalts der „Bild-Zeitung“ haben den Nachweis erbracht, daß dieses Blatt seit Jahren immer wieder seine Leser einseitig, lückenhaft und unsachlich informiert … Sie scheut nicht davor zurück, die Wahrheit zu verfälschen, wenn mit der Unwahrheit Ressentiments aufgerührt werden konnten. Die „Bild-Zeitung“ spiegelt sehr deutlich wider, wie Zeitfragen von einem Teil unserer Gesellschaft, und zwar von den intellektuell wenig Geschulten, von einseitig Orientierten und halb Informierten erörtert werden. Dieses Gespräch ist durchsetzt mit Halbwahrheiten, Neid, Haß und Vorurteilen, mit Dummheit, Spießbürgertum und Desinteresse.
 Schon mit der ersten Ausgabe des Jahres 1968 hatte der „Spiegel“ eine achtteilige Serie über Axel Springer begonnen („Ich werde Deutschland wiedervereinigen, ob Sie es glauben oder nicht“). Darin unter anderem auch ein „Psychogramm Axel Springers“ von Wilhelm Backhaus, der pikanterweise jahrelang als Kolumnist für Springer schrieb und die Bedeutung von „Bild“ so zusammenfasste:
Schon mit der ersten Ausgabe des Jahres 1968 hatte der „Spiegel“ eine achtteilige Serie über Axel Springer begonnen („Ich werde Deutschland wiedervereinigen, ob Sie es glauben oder nicht“). Darin unter anderem auch ein „Psychogramm Axel Springers“ von Wilhelm Backhaus, der pikanterweise jahrelang als Kolumnist für Springer schrieb und die Bedeutung von „Bild“ so zusammenfasste:
In Deutschland hingegen sind seit dem Kriege gerade Minderwertigkeitsgefühle und Ressentiments verlegerisch zu nutzen, und das gelang Springer mit dem kongenialen Chefredakteur von „Bild“, Peter Boenisch, noch auf eine besondere, viel gefährlichere Weise. Sie erreichten es, daß sich der Konsument von „Bild“ nicht mehr mit dem Lesen begnügt; er wird aktiviert, man animiert ihn zur Zuschrift, man redet ihm ein, daß seine Stimme Volkes Stimme sei, daß Deutschland durch seinen Mund spricht.
So ist das Millionenheer der „Bild“-Leser bewußt zu einer politischen Macht aufgebaut worden, die ebenso bewußt gelenkt wie ausgespielt werden kann. Ihr Gewicht ist längst viel zu groß, als daß irgendein Politiker es noch wagt, sich ihr entgegenzustellen. Daß dies keine bloß konstruierten Spekulationen sind, hat Springer selbst durch die wiederholte Behauptung bestätigt, er und seine Politik erhielten ihren Auftrag, ihre Legitimation durch die tägliche Millionenzahl seiner Zeitungskäufer und -leser.
Am 22. Januar beschrieb der „Spiegel“ das Verhältnis zwischen Axel Springer und dem „Bild“-Chefredakteur Peter Boenisch:
(…) „Bild“-Boenisch weiß, was der „Bild“-Verleger wünscht — edel sein oberhalb der Rentabilitätsgrenze.
Um dieses respektablen Ziels willen wird täglich der eklige „Bild“-Brei aus Blut, Tränen und Hormonen angerührt und an Millionen Leser verfüttert. Es Boenisch vorzuhalten, hieße einem Marinaden-Händler den Matjes-Geruch ankreiden. Eine Zeitung, die täglich von fünf Millionen Deutschen gekauft werden soll, muß widerwärtig sein. (…)
Selbst die „Spiegel“-Leserbriefe jener Zeit sind lesenwert:
Als Zeitungs- und Zeitschriftenhändler, der sich gegen die einseitige, uniformierte Meinungsmache der Springer-Presseerzeugnisse zur Wehr setzte und in Leserbriefen (auch im SPIEGEL, wie extra vom Chefjustitiar erwähnt wurde) seiner Meinung Ausdruck gab, wurde mir von einem zum anderen Tag die Belieferung aller im Springer-Verlag erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften gesperrt; „damit wurde meine Existenzgrundlage vernichtet.
Ich begrüße daher die SPIEGEL-Serie über diesen Mammutkonzern, der nicht diskutieren will, sondern jeden, der sich die veröffentlichte Meinung dieser Blätter nicht aufzwingen läßt und widerspricht, unter Druck setzt. Ich hoffe, daß dieser Presse-Allmacht recht bald die Flügel beschnitten werden, damit unsere Demokratie lebendig bleibt und nicht im Sumpf diktatorischer Gleichmacherei zur Farce wird.
Mellendorf (Nieders.) HERMANN PIEPERGebt Springer auch den Rest der Presse, dann hält die Wahrheit ganz die Fresse!
Berlin ALEX ARMBRÜSTERStärkt Axel Springer, bekämpft alle Pinscher!
Eschborn (Hessen) WILHELM HÖRNICKE
Und genüsslich zitierte das Nachrichtenmagazin, was Axel Springer über den „Spiegel“ sagte – natürlich nicht dem „Spiegel“ direkt, sondern in einem Fernsehgespräch:
In der Sendung „Dialog“ des Zweiten Deutschen Fernsehens fragte Klaus Harpprecht am vergangenen Donnerstag Axel Springer, was er von der Kritik an seinem Konzern halte:
SPRINGER: Ich würde sagen, die Angriffe im SPIEGEL und „Stern“, die berühren mich wenig, fast gar nicht. Ich will hier etwas verraten: Ich lese die auch nicht. Es ist der Ratschlag eines guten Freundes, sie nicht zu lesen. Ich lasse sie lesen. Das, was dort an perfiden Dingen, unwahren Dingen über mich gesagt worden ist und über unser Haus gesagt worden ist, da haben mich die juristischen Berater meines Hauses belehrt, daß man heutzutage da nicht einschreiten kann. Wir haben es also auch gelassen.
Wenn man all das heute liest, fällt auf, mit wieviel Leidenschaft und teilweise offensichtlicher Lust sich der „Spiegel“ in die Auseinandersetzung mit Springer stürzte — natürlich auch selbst nicht frei von Ideologie, aber in beeindruckender Breite und Tiefe, mit vielen Dokumentationen und offenkundig getragen von dem Gefühl der großen Bedeutung dieses Themas.
Die Bedienung des neuen „Spiegel“-Wissensportals ist noch ein ziemlicher Alptraum. Aber die Schätze, die sich darin finden, lohnen das mühsame Graben. Und weil sich alle Artikel unmittelbar verlinken lassen und ohne Registrierung gelesen werden können, wird das Archiv allmählich von Google entdeckt werden, und bei irgendwelchen Suchen wird man ganz selbstverständlich auf „Spiegel“-Artikel aus vergangenen Jahrzehnten stoßen. Das ist, nicht nur wenn es um die 68er geht: revolutionär.
Pop-Songs erobern die Charts (2)
Turkey, Ireland, twelve points
Mangelnde Ausdauer kann man ihnen nicht vorwerfen. Jahr für Jahr haben die Iren versucht, an die Grand-Prix-Erfolge aus den Achtzigern und Neunzigern anzuknüpfen und wieder und wieder möchtegerngroße pathetische Hymnen ins Rennen geschickt, gerne mit der Botschaft, dass wir uns alle viel öfter an die Kerzen fassen und die Hände anzünden sollten (oder umgekehrt). Alternativ kamen aus Irland ähnlich berechenbare billige Balladen, schiefe Popfolklore oder traurige Gewinnerkopien.
Jetzt haben sie kapituliert. In den diesjährigen Wettbewerb in Belgrad hat das irische Fernsehpublikum gestern gewählt: einen Truthahn. Dustin The Turkey mit „Ireland Douze Pointe“:
Nun hat die Diskussion begonnen, ob dieser Vogel für Irland singen darf oder der Eurovision Song Contest insgesamt längst den Bach runter gegangen ist. Aber am besten gefällt mir die Formulierung des „Guardian“, der schreibt, die Puppe aus dem Kinderprogramm hätte gewonnen, „obwohl“ sie von Bob Geldof unterstützt wurde.
Pop-Songs erobern die Charts
Grimme-Kandidaten gucken (2)
Wer sehen will, was wir vor zwei, drei Wochen in der Grimme-Jury in Marl gesehen haben: Das ZDF zeigt heute Abend „Das Geld anderer Leute“ aus der feinen Krimireihe „Unter Verdacht“. Die Geschichte hat ein paar logische Löcher, aber es ist gute Unterhaltung — und vor allem ein großes Vergnügen, Senta Berger und Rudolf Krause zuzusehen.
Unter Verdacht, heute, 20.15 Uhr, ZDF.
Aktenzeichen XY … unzutreffend
Das FBI hat in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch mit dem Foto eines völlig unbescholtenen Urlauberpaares aus Deutschland nach einem Schwerverbrecher gesucht. Der Sender nahm den Fehler mit „Bestürzung“ auf, gab aber laut dpa Entwarnung:
Das unverdächtige Paar könne sicher sein, dass sein Urlaubsfoto nicht weiter um die Welt gehe.
Na, dann ist ja nicht so schlimm.
(Aber sollte nicht wenigstens jemand dem FBI Bescheid sagen?)
Falschparker auf Eva Hermans Autobahn
Eva Herman erzielt gegen das deutsche Meinungskartell einen juristischen Sieg nach dem nächsten, aber weil die Medien gleichgeschaltet sind, berichtet keiner darüber. Kann das sein? Es sieht so aus. Auf ihrer Homepage hat die frühere Fernsehmoderatorin und „Tagesschau“-Sprecherin vor zwei Wochen eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach sie erfolgreich gegen das ZDF und die Nachrichtenagentur dpa vorgegangen sei. Widerhall fand diese Meldung aber fast nur in, sagen wir: speziellen Medien – bei der rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“, der evangelikalen Agentur „Idea“ und dem erzkatholischen Verein „Kath.net“.
Warum steht das sonst nirgends? Hatte Eva Herman vielleicht Recht mit ihrer Rede von der „Gleichschaltung“ der deutschen Medien?
Nicht ganz. Je genauer man sich die vermeintlichen juristischen Erfolge von Frau Herman ansieht, umso weniger spektakulär sind sie. Deshalb wird es jetzt ein wenig fisselig.
In der Auseinandersetzung mit dpa geht es um eine Formulierung, die die Nachrichtenagentur verwandte, als sie über Hermans Auftritt bei Johannes B. Kerner berichtete:
Zuvor hatte Kerner fast 50 Minuten lang die 48-Jährige immer wieder gefragt, ob sie ihre Äußerungen zu den familiären Werten im Nationalsozialismus heute so wiederholen würde. Doch Herman wich mehrfach aus und ergänzte: Wenn man nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe, könne man auch nicht über die Autobahnen sprechen, die damals gebaut wurden.
Es ist kein Zufall, dass der letzte Satz nicht in Anführungszeichen steht, denn Eva Herman hat ihn nicht gesagt, auch nicht ungefähr. Tatsächlich ging es bei ihrem inzwischen berüchtigten Autobahn-Vergleich nicht um die Familienwerte der Nazis, sondern darum, dass sie auch auf mehrfache Nachfrage nicht davon lassen wollte, von einer „gleichgeschalteten Presse“ in der heutigen Bundesrepublik zu sprechen. Auf die Vorhaltung, es handele sich um einen Begriff aus dem Dritten Reich, sagte sie:
Natürlich ist er da benutzt worden. Aber es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf.
Die irreführende Formulierung aus der dpa-Meldung verbreitete sich besonders rasch, weil dpa exklusiv aus der Aufzeichnung der Sendung berichtete. Die Meldung lief schon um 20.09 Uhr, also mehr als zwei Stunden, bevor die Show ausgestrahlt wurde. dpa wiederholte die Darstellung um 20:41 Uhr und noch einmal spät in der Nacht. Vom Mittag des folgenden Tages an zitierte dpa Herman wörtlich, korrekt und im richtigen Zusammenhang, korrigierte die vorherige Darstellung aber nie ausdrücklich.
Frau Herman verlangte von dpa nun unter anderem, die Meldungen zurückzuziehen, was die Agentur ablehnte. Das Landgericht Köln schlug einen Vergleich vor. Danach muss dpa die damaligen Meldungen nicht nachträglich zurückziehen oder korrigieren, verpflichtet sich aber, in Zukunft nicht wieder zu verbreiten, dass Eva Herman gesagt habe: „Wenn man nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe, könne man auch nicht über die Autobahnen sprechen, die damals gebaut wurden.“ Das Gericht erließ ein entsprechendes „Teilanerkenntnisurteil“.
Dieser Vergleich ist zwar ein Erfolg für Eva Herman, bleibt aber hinter ihren ursprünglichen Forderungen zurück. Im Protokoll der Gerichtsverhandlung formuliert die Kammer es nur als Frage, ob die dpa-Meldung „im Kern wahr, aber vergröbernd“ war oder es sich um ein unzulässiges Zitat handelte. Bezeichnend ist auch, dass dpa nach diesem Vergleich nicht für die Anwaltskosten Eva Hermans aufkommen müsse, sondern beide Seiten ihre eigenen Auslagen tragen und sich die Gerichtskosten teilen würden.
Mit dieser Aufteilung ist Frau Herman aber nicht einverstanden. Sie hat deshalb, wie ihr Anwalt Gerrit Schohe erklärt, jetzt nachträglich ihre Zustimmung zu dem Vergleich im Bezug auf die Kosten zurückgezogen. Nun muss das Gericht diesen Punkt entscheiden. (Ich hatte Sie ja gewarnt, dass es fisselig werden würde.)
Im Streit mit dem ZDF geht es um einen offenbar satirisch gemeinten Jahresrückblick in der Sendung „Aspekte“ vom 14. Dezember 2007. Wolfgang Herles hatte darin Hermans Äußerungen so zusammengefasst, „bei den Nazis sei nicht alles schlecht gewesen, ja sogar manches gut“ und: „Das sind Werte, das sind Kinder, Mütter, Familien, das ist Zusammenhalt.“ Wie das ZDF bestätigt, hat der Sender tatsächlich nach Aufforderung durch die Anwälte Hermans eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben. Allerdings, und das ist nicht unwesentlich: ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Das bedeutet im Grunde, dass das ZDF der Meinung ist, freiwillig auf eine Wiederholung der Formulierungen zu verzichten (was dem Sender leicht fällt, da es sich ja um einen Jahresrückblick 2007 handelt), sie aber im Grunde insbesondere im Rahmen einer satirischen Darstellung für zulässig zu halten. Um die Übernahme der Anwaltskosten streiten sich Herman und das ZDF noch — womöglich bald auch vor Gericht. Einen großen „juristischen Erfolg“ Hermans zu verkünden, wäre also mindestens voreilig.
Eva Herman aber sagt:
„Es wurde Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das war erst der Anfang. Nun geht es weiter.“
Generation Kerner
Unlängst telefonierte ich mit dem Bestsellerautor Stefan Bonner.
Bestseller-Autor war Bonner da noch nicht; es war bloß kurz zuvor ein Buch erschienen, das er zusammen seiner Kollegin Anne Weiss 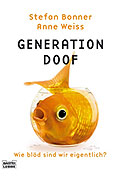 geschrieben hatte.
geschrieben hatte.
Doch nachdem Bild.de am vergangenen Freitag das Buch „Generation Doof“ u.a. mit der darin enthaltenen Falschbehauptung anpries, dass sich ein „Wer wird Millionär?“-Kandidat auf die Frage nach dem Vornamen von George W. Bush für die Antwort „Edmund“ entschieden habe, hatte ich Autor Bonner plötzlich am Apparat. (Ein Anruf bei der Pressestelle des „Generation Doof“-Verlags Lübbe wurde zu meiner Überraschung direkt zu den Autoren durchgestellt, die, so steht’s in ihren Kurzbiografien bei luebbe.de, „Lektoren in einem großen deutschen Publikumsverlag“ seien).
Wo ich Bonner schon mal dran hatte, nutzte ich die Gelegenheit, ihn auch auf die „Bush“-Ente hinzuweisen, die er und Weiss offenbar ungeprüft aus dem Internet rüberkopiert hatten. Bonner gab sich verblüfft — und erwiderte sinngemäß, das sei ja dann wohl der beste Beweis für die Generation Doof, haha…
Das war, wie gesagt, am vergangenen Freitag. Und am vergangenen Dienstag erschien bei „Spiegel Online“ ein Interview mit Weiss und Bonner, das dem Erfolg des Buchs (derzeit Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste) nicht geschadet haben dürfte. „Spiegel Online“ stellt darin aber auch die gar nicht doofe Frage:
Sie halten sich selbst für Mitglieder der „Generation Doof“. Wie haben Sie es dann geschafft, an Lektorenjobs in einem großen deutschen Publikumsverlag zu kommen?
Autorin Weiss antwortet:
(…) man braucht auf jeden Fall ein bisschen Talent, seine gelegentliche Dummheit gut zu kaschieren. Außerdem ist es gut, die Recherchemöglichkeiten zu kennen, also zu wissen, wo man eine fehlende Information schnell findet.
Und ihr Kollege Bonner ergänzt:
Dann ist noch eine gewisse Kritik- und Lernfähigkeit nötig. (…)
 Soviel zur Theorie. Doch am selben Abend saßen Weiss und Bonner bei Kerner.
Soviel zur Theorie. Doch am selben Abend saßen Weiss und Bonner bei Kerner.
Und als Kerner schließlich (Video ab ca. 10’51“) anhob, ausführlich, begeistert und sichtlich unbeleckt die „Wie heißt George W. Bush“-Anekdote nachzuerzählen (auf deren Falschheit ich die „Doof“-Autoren doch noch persönlich hingewiesen hatte), da saßen Weiss und Bonner da, nickten — und hielten lächelnd ihre Klappe.
Manchmal glaube ich: Woran unsere Gesellschaft krankt, ist nicht Dummheit, sondern die Schlauheit, andere für dumm zu verkaufen.
[Nachtrag: Überschrift geklaut bei Torsten Kleinz.]