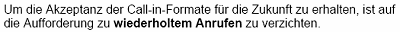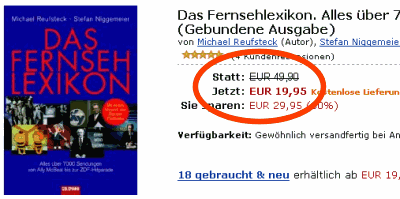Gelegentlich wird BILDblog ja vorgeworfen, unsere Arbeit sei schon deshalb unsinnig, weil die meisten Leser eh nicht glaubten, was in der „Bild“-Zeitung steht. Interessanterweise aber glauben Journalisten, was in der „Bild“-Zeitung steht. Tag für Tag übernehmen sie „Bild“-Meldungen ungeprüft in ihre eigenen Medien — nicht nur in den Redaktionen der Boulevardmagazine im Fernsehen, auch bei vermeintlich seriösen Medien und deren Online-Ablegern.
Am vergangenen Wochenende fielen sie reihenweise auf das „Bild“-Märchen von Angelina Jolies „Schock-Beichte“ herein, mit dem das Blatt groß aufmachte.
Zum Beispiel das Online-Angebot von der „Rheinischen Post“. Nach meiner Wahrnehmung bestückt kaum ein anderer Online-Ableger sein Angebot so konsequent mit selbst umgeschriebenen „Bild“-Meldungen, was natürlich damit zusammenhängen könnte, dass sowohl Zeitungs- als auch Online-Chef von „Bild“ kommen. Jedenfalls hieß es auf „RP Online“:
Angelina Jolies schockierende Sex-Beichte
Sie gehört zu den schönsten Frauen Hollywoods aber auch zu den exzentrischtsten. Angelina Jolie ist Schauspielerin, Mutter und Femme fatale zu gleich. Jetzt geht die 31-Jährige mit einem intimen Buch an die Öffentlichkeit und gesteht: „Ich wollte eine Frau heiraten!“ (…)
Das ist Quark und (mal ganz abgesehen von den sprachlichen Schwächen) sogar noch falscher als die „Bild“-Geschichte. „Bild“ hatte nämlich nur geschickt suggeriert, das Buch sei von Angelina Jolie selbst. Inzwischen glaubt anscheinend auch „RP Online“ nicht mehr an die Richtigkeit des eigenen und des „Bild“-Artikels:
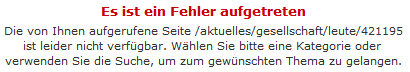
„Spiegel Online“ konnte ebenfalls nicht widerstehen, verbreitete den Unsinn von „Bild“ ebenfalls weiter — und nannte das aus alten Zitaten zusammengequirlte Buch entsprechend schon in der Dachmarke ein „ENTHÜLLUNGSBUCH“. Bei „Spiegel Online“ ist der Artikel auch heute noch online, aber in einer leicht veränderten Version. Der ursprüngliche Satz „In wenigen Tagen kommt die Biographie der schönen Schauspielerin in Deutschland auf den Markt“, bekam den Nebensatz: „die allerdings nicht autorisiert ist.“
Hm. Sah es zwischenzeitlich nicht mal so aus, als würde „Spiegel Online“ solche nachträglichen Korrekturen kenntlich machen? Oder gilt das nicht für Verschlimmbesserungen — denn um die Frage der Autorisierung geht es eigentlich gar nicht. Die Zitate, die „Bild“ aus dem Buch bringt, kommen teilweise durchaus aus respektablen Quellen, sind also vermutlich auch autorisiert, aber eben schon viele Jahre alt. Was will uns „Spiegel Online“ also mit dieser Änderung sagen? Auf eine Anfrage an „Spiegel Online“-Chef Mathias Müller von Blumencron habe ich leider keine Antwort erhalten.
Geantwortet hat mir aber Hans-Jürgen Jakobs, Chef von sueddeutsche.de. Der Internet-Auftritt der „Süddeutschen Zeitung“ hatte, wie „RP Online“, die „Bild“-Fehler noch verschärft:
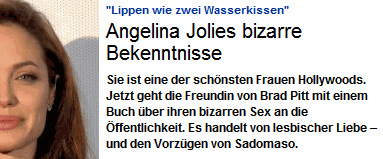
Nachdem BILDblog über den Fall berichtet hatte, wurden ein paar merkwürdige Sätze in den Text redigiert, die (wie bei „Spiegel Online“) am Kern vorbeigingen:
Bei diesem Buch handelt es sich um eine unautorisierte Biographie. (…) Aber wie gesagt: Das Buch „Angelina Jolie“ zitiert Angelina Jolie rauf und runter, aber Angelina Jolie selber hat dieses Buch nie autorisiert.
Am Dienstagnachmittag teilte mir Jakobs auf meine grundsätzlichen Fragen zum Umgang mit „Bild“ folgendes mit:
Gibt es bei sueddeutsche.de Regeln für den Umgang mit Quellen im Allgemeinen und „Bild“ im Besonderen?
Der Umgang mit Quellen unterscheidet sich bei sde nicht von den Prinzipien der Süddeutschen Zeitung oder anderer etablierter Medien. In der Regel werden Nachrichten mit Quellenangaben zitiert, wie auch in dem von Ihnen betrachteten Fall.
Gelten vermeintliche „Bild“-Exklusiv-Meldungen bei sueddeutsche.de grundsätzlich als vertrauenswürdig? Und sogar so vertrauenswürdig, dass die Redakteure auf eine Plausibilitäts-Kontrolle durch eine kurze Google-Suche verzichten können?
Die Meldung beruhte auf einer „Bild“-Geschichte, die am Samstag erschien. Am Wochenende sind in der Regel die Personenen aus den Ressorts Panorama und Leben & Stil nicht im Büro. Zu einer gesonderten Überprüfung kam es in diesem speziellen Fall nicht. Die sde-Seite, auf die BildBlog zunächst verlinkt hat, ist längst gelöscht.
Ich kann mich ja irren, aber ich habe das Gefühl, Herr Jakobs hat zwar meine Mail, aber nicht meine Fragen beantwortet.
Tatsächlich erhält aber, wer den Angelina-Jolie-Artikel auf sueddeutsche.de aufruft, nun dies:
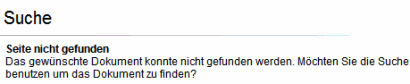
Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich unter dem Artikel eine lange, heftige und teilweise kontroverse Diskussion entwickelt hatte:
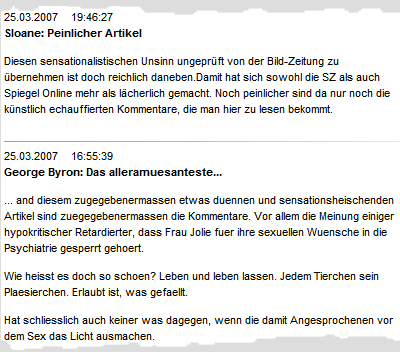
Mehrere Dutzend Leserkommentare sind nun, zusammen mit dem Artikel, gelöscht worden. Wenn diese Kommentare ein Mittel sein sollen, um Leser zu binden, und wenn Hans-Jürgen Jakobs beim Relaunch von sueddeutsche.de einen „verstärkten Dialog mit den Lesern“ ankündigte: Wie wirkt das eigentlich auf Leser, wenn eine Diskussion, an der sie sich beteiligt haben, und ihr Gegenstand ohne Erklärung von einer Minute auf die andere verschwindet?
Und: Woran erkennt man nochmal ein Qualitätsmedium im Netz? An seinem Umgang mit zweifelhaften Nachrichtenquellen? An der Transparenz, wie es mit eigenen Fehlern umgeht? An seinem Umgang mit Leserkommentaren? Oder doch nur daran, dass es sich für etwas Besseres hält?