In Großbritannien und den Niederlanden wird aus unterschiedlichen Gründen gegen die Veranstalter von kostenpflichtigen Gewinnspielen und Abstimmungen im Fernsehen vorgegangen. In Großbritannien wegen Betrugs. In den Niederlanden, weil es sich möglicherweise um unerlaubtes Glücksspiel handelt.
Und in Deutschland? Müsste man gegen die Sendergruppen von ProSiebenSat.1 und MTV sowie das DSF eigentlich aus beiden Gründen vorgehen.
Betrug?
Sämtliche Veranstalter ignorieren die Empfehlungen der Landesmedienanstalten und informieren konsequent falsch über Spieldauer, Spielchancen, Spielmodus, Schwierigkeitsgrad, Lösungsweg und (im Fall von Viva/Nick/Comedy Central) sogar die Gewinnsumme. Vor allem in den Sendungen, die von der Firma Callactive für die MTV-Sender produziert werden, wird aber noch mit ganz anderen Tricks gearbeitet.
Ein Beispiel: Die Sendung „Quiz Zone“ ist täglich am späteren Abend mehrere Stunden lang auf dem Kindersender (!) Nick zu sehen. Sie läuft fast jeden Tag nach dem gleichen Schema ab. Am Anfang werden ein paar kleine Gewinne ausgespielt. Dann beginnt ein Spiel, in dem es scheinbar viel Geld zu gewinnen gibt (zum Beispiel „50 Geldpakete“ oder mehrere tausend Euro). In diesem Spiel gibt es in aller Regel bis eine Minute vor Ende der Sendung keinen Gewinner. Es werden Leitungen geöffnet und geschlossen, Countdowns gezählt, falsche Endzeiten der Sendung angegeben, die Gewinnsummen vervielfacht und wieder reduziert, Spiele ungelöst abgebrochen, aber einen Gewinner gibt es bis unmittelbar vor Ende der Sendung nicht. Und das, obwohl in der „Quiz Zone“ auch vorher immer wieder angebliche Anrufer ins Studio gestellt werden. Diese angeblichen Anrufer geben aber entweder falsche Antworten, brabbeln unverständliches Zeug oder legen einfach wieder auf.
Dieser Spielablauf ist im Prinzip jeden Abend gleich. Wenn deutlich vor Ende der Sendung bei hohem Gewinnversprechen jemand ins Studio gestellt wird, kann man sicher sein, dass er die Antwort nicht weiß. Ein Gewinner wird erst unmittelbar vor Ende der Sendung, dann meist bei deutlich reduzierter Gewinnsumme, durchgestellt.
Man kann sich in den entsprechenden Foren von call-in-tv.de Dutzende von protokollierten „Quiz Zone“-Sendungsverläufen durchlesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Sendungsverläufe zufällig ergeben, liegt ungefähr bei null. Die einzig plausible Erklärung für die Art, wie die Sendung „Quiz Zone“ Abend für Abend verläuft, ist die, dass die frühen Falschanrufer und Aufleger keine echten Anrufer sind, sondern von Callactive gefaked werden, um dem Zuschauer vorzutäuschen, er habe eine Chance, schon vor Ende der Sendung durchzukommen.
Um es deutlich zu sagen: Ich kann nicht beweisen, dass Mitarbeiter der Firma selbst bei „Quiz Zone“ anrufen und gezielt durchgestellt werden, um falsche Antworten zu geben, und die Zuschauer so — zusätzlich zu der Vielzahl von falschen oder irreführenden Einblendungen und Moderatoren-Aussagen — betrogen werden. Ich habe keine Aussage von einem Aussteiger aus der Szene und auch kein internes Callactive-Papier vorliegen. Ich habe nur die bloße Anschauung als Indiz, aber das ist sehr überzeugend. Sagen wir so: Wenn ein Poker-Spieler jeden Abend den gleichen „Royal Flush“ hinblättert, nehme ich bis zum Beweis des Gegenteils an, dass seine Karten gezinkt sind.
(Callactive ist übrigens eine Tochter von „Wer wird Millionär“-Produzent Endemol. Eine andere Tochter von Endemol ist maßgeblich in den britischen Betrugsskandal verwickelt. Die Welt ist klein.)
Verbotenes Glücksspiel?
Nach Paragraph 284 StGB wird bestraft, wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet. Erlaubt sind dagegen zum einen Geschicklichkeitsspiele, bei denen die Teilnehmer bestimmte Fähigkeiten oder Kenntnisse unter Beweis stellen müssen, um zu gewinnen, und zum anderen Preisausschreiben oder Gewinnspiele, bei denen Teilnehmer keinen erheblichen Einsatz erbringen müssen.
Geht es bei den 9Live-Spielen um Wissen, Fähigkeiten oder Geschick? Teilweise ja — wenn die Aufgabe etwa lautet, sieben Tiere zu nennen, deren dritter Buchstabe ein „U“ ist. (Wobei die eigentliche Aufgabe häufig darin besteht, die überhaupt geltenden Regeln zu erraten, was wiederum nichts mit Geschick zu tun hat.) Der Bundesgerichtshof urteilte allerdings:
Ein Glücksspiel liegt auch dann vor, wenn der Spielerfolg nicht allein vom Zufall abhängt, dem Zufallselement aber ein Übergewicht zukommt.
Bei den Telefon-Gewinnspielen von 9live und anderen entscheidet der Zufall darüber, ob man überhaupt ins Studio durchgestellt und am eigentlichen Gewinnspiel teilnehmen darf. Experten wie die Rechtsanwälte Manfred Hecker und Markus Ruttig folgern daraus, dass solche Spiele in jedem Fall als Glücksspiele einzuordnen seien — selbst wenn das „nachgelagerte Spiel“ tatsächlich eine besonderes Geschick erfordert.
Bleibt die Frage, ob der Einsatz, den der Spieler zur Teilnahme leisten muss, „erheblich“ ist. Es ist kein Zufall, dass ein Anruf bei den Abzocksendern meist 50 Cent kostet. Das entspricht ungefähr den Kosten einer Postkarte und gilt damit nach der üblichen Rechtsprechung als „unerheblich“. Durch die Einführung einer solchen „Geringfügigkeitsgrenze“ haben die Gerichte vor Jahrzehnten verhindert, dass durch das Verbot des Glücksspiels gleichzeitig auch Kreuzworträtsel oder Preisausschreiben verboten wurden. An die Wiederholtaste beim Telefon, die interaktiven Medien, das erheblich höhere Suchtpotential eines Live-Anruf-Quiz und die Möglichkeit, dass der Veranstalter an den erheblichen Einnahmen aus den Telefongebühren beteiligt werden könnte, hatte zu der Zeit, aus der diese Rechtsprechung stammt, noch niemand gedacht.
Ist der Einsatz bei 9Live & Co. also „erheblich“? Wenn man den einzelnen Anruf zu 50 Cent betrachtet: natürlich nicht. Andererseits ist die gesamte Sendekonzeption offensichtlich auf eine wiederholte Teilnahme und dadurch de-facto eine Erhöhung des Einsatzes angelegt. Rechtsanwalt Hecker meint deshalb, man müsse den Gesamteinsatz eines Teilnehmers für ein Spiel berücksichtigen. Dann wäre der Einsatz alles andere als „geringwertig“. (Zum Beispiel wurde eine Rentnerin 2005 zur Zahlung von 23.087,10 Euro verurteilt, weil sie in 44 Tagen insgesamt 47.024 mal bei 9Live angerufen hat, ähnliche Fälle sind immer wieder in 9Live-Sendungen zu hören.)
Würde man immer nur den Einzeleinsatz betrachten, müsste es konsequenterweise auch zulässig sein, so Hecker, „ohne Erlaubnis in der Öffentlichkeit einen Rouletttisch aufzustellen, an dem nur mit Jetons zu 50 Cent gespielt werden kann und jeder Mitspieler bei jedem einzelnen Lauf nur einen Jeton legen darf.“
Die meisten Gerichte haben sich dieser realistischen Bewertung der Höhe des Einsatzes jedoch noch nicht angeschlossen. Immerhin hat aber sogar das Oberlandesgericht München in seinem Urteil, in dem es die 9Live-Spiele für grundsätzlich zulässig erklärte, einschränkend hinzugefügt:
3. Eine Wettbewerbswidrigkeit ist nur dort gegeben, wo ein Moderator vortäuscht, dass keine Teilnehmer anrufen würden, obwohl dies nicht zutrefft, um Personen zur Teilnahme zu bewegen. (…)
5. Die Unerheblichkeit [des Einsatzes] kann (…) dann überschritten werden, wenn der Teilnehmer zu mehrmaligen Anrufen aufgefordert und motiviert wird.
Komisch. Wann immer ich eine Sendung von 9Live oder Callactive einschalte, muss ich nicht lange warten, bis der Moderator vortäuscht, dass keine Teilnehmer anrufen würden, oder die Zuschauer motiviert, mehrmals anzurufen.
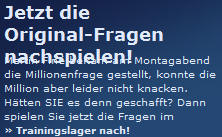
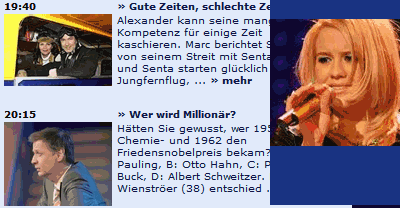
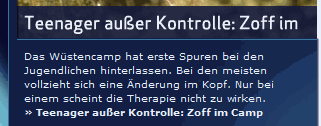
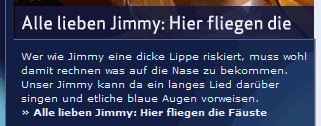

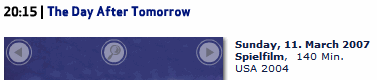
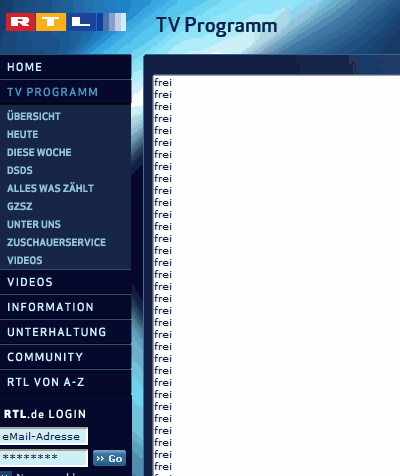
 Was ich wirklich nützlich finde: „Focus Online“ gibt in der Regel schon auf der Startseite an, wann ein Artikel veröffentlicht wurde. Das ist bei einem Angebot, das sich kontinuierlich und schnell verändert, eine zentrale Information. Man muss nur einmal versuchen wollen, bei „Spiegel Online“ herauszufinden, von wieviel Uhr ein bestimmter Artikel stammt — welchen Stand aktueller Entwicklungen er wiedergibt. Es ist fast unmöglich. Es sei denn, man kennt den Trick, ganz unten auf der Seite auf
Was ich wirklich nützlich finde: „Focus Online“ gibt in der Regel schon auf der Startseite an, wann ein Artikel veröffentlicht wurde. Das ist bei einem Angebot, das sich kontinuierlich und schnell verändert, eine zentrale Information. Man muss nur einmal versuchen wollen, bei „Spiegel Online“ herauszufinden, von wieviel Uhr ein bestimmter Artikel stammt — welchen Stand aktueller Entwicklungen er wiedergibt. Es ist fast unmöglich. Es sei denn, man kennt den Trick, ganz unten auf der Seite auf  Ebenfalls interessant am neuen „Focus Online“: Vor den Videos laufen Werbespots. Das ist gewagt, solange die vermeintlichen „Focus Online“-Videos noch Reuters-Videos sind — also die, die überall laufen, auch ohne Werbung. Und ist es wirklich eine gute Idee, vor dem Reuters-Video, das nur aus einem ernsten O-Ton des Außenministers über die Geiselnahme im Irak besteht, einen Werbespot zu zeigen, in dem Opel den Zuschauern Fahrspaß garantiert? Ist das der Ort, an dem Opel werben will? Funktioniert das? Insbesondere in einem Land, wo die Menschen es von ihrem Fernsehen gewohnt sind, dass Nachrichten nicht von Werbung unterbrochen werden?
Ebenfalls interessant am neuen „Focus Online“: Vor den Videos laufen Werbespots. Das ist gewagt, solange die vermeintlichen „Focus Online“-Videos noch Reuters-Videos sind — also die, die überall laufen, auch ohne Werbung. Und ist es wirklich eine gute Idee, vor dem Reuters-Video, das nur aus einem ernsten O-Ton des Außenministers über die Geiselnahme im Irak besteht, einen Werbespot zu zeigen, in dem Opel den Zuschauern Fahrspaß garantiert? Ist das der Ort, an dem Opel werben will? Funktioniert das? Insbesondere in einem Land, wo die Menschen es von ihrem Fernsehen gewohnt sind, dass Nachrichten nicht von Werbung unterbrochen werden?