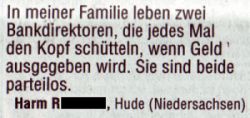Diese Woche war ich mal wieder in Münster. Ich komme ja aus Osnabrück, das liegt gleich um die Ecke, und früher waren wir da öfter zum Einkaufen oder zu Besuch im sogenannten All-Wetter-Zoo.
Diesmal war ich in Münster, um zuzusehen, wie „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann in der Burschenschaft auftritt, in der er Mitglied ist: der „Franconia“, einer Verbindung, die unter anderem von der SPD als rechtsextrem eingestuft wird. Das Verbindungshaus der Franconia heißt „Frankenhaus“ und ist ein Klinkergebäude, das von außen wie ein größeres Zweifamilienhaus aussieht. Es liegt an der Himmelreichallee, was ich erst ziemlich lustig fand, aber vermutlich nur mit dem benachbarten Zentralfriedhof zu tun hat. Zig Fahrräder vor dem Haus deuteten auf reges Interesse, von gegenüber schallte aus den Probenräumen der Musikschule ein sympathisches musikalisches Durcheinander.
Der Abend war sehr warm, und es schien vor allem zwei Gruppen von Besuchern zu geben: Zum einen graumelierte Herren, unter deren offenen Jacketts und Mänteln man die schräg über die Brust laufenden bunten Bänder sah, die sie als Mitglieder der Verbindung auswiesen. Die Franconia ist eine farbentragende und schlagende Verbindung — aber um irgendwelche Narben zu sehen, war es zu dunkel. Zum anderen junge Leute, die ich für mich erleichtert als „ganz normal“ einsortierte. Alberner Gedanke, schon klar. Ich wusste auch nicht, wie genau ich mir eingefleischte, aktive Burschenschafter vorstellen sollte. Jedenfalls schienen einige Leute, wie ich, zum ersten Mal hier zu sein. Es war eine öffentliche Veranstaltung, für die in Münster auch geworben wurde. Deshalb war ich einfach hin zur Franconia, nachdem ich auf zwei Anfragen per „E-Post“ (so heißt das bei denen), ob ich mich anmelden müsse oder einfach kommen könne, keine Antwort bekommen hatte.
Mit einer Gruppe kichernder junger Frauen ging ich ins Haus. Ein bärtiger junger Mann mit Mütze und Band, der nun doch dem Klischee in meinem Kopf von einem Burschenschafter recht nahe kam, hielt uns und den anderen von innen die Tür auf. Und während alle anderen vor und hinter mir unbehelligt weitergingen, winkte er mich zu sich rüber und fragte nach meinem Namen. Meine Antwort schien er schon erwartet zu haben, und dann er teilte er mir bedauernd mit, dass ich nicht willkommen sei. Herr Diekmann habe ausdrücklich gesagt, dass er meine Anwesenheit nicht wünsche, und Herr Diekmann sei nun einmal der Gast, und ich hätte sicher Verständnis dafür, dass man solchen Wünschen der „Bild“-Redaktion entspreche.
Das verstand ich, und das sagte ich auch dem Türsteher. Ich verstand nur nicht, warum man mir das nicht mitgeteilt hatte. Zum Beispiel als Antwort auf meine zwei E-Posts E-Posten E-Pöste E-Mails. Doch, sagte der Mann, natürlich habe man mir geantwortet. Und als ich wiederholte, dass ich wirklich nichts bekommen hätte, sagte er betrübt, dann müsse wohl technisch etwas schiefgelaufen sein.
Ja, so Pannen passieren. Wenigstens hatte es technisch geklappt, dafür zu sorgen, dass der Bursche vom Dienst mich am Eingang erkennen würde.
So war das, bei der Franconia. Erstaunlich, um was sich „Bild“-Chefredakteure so neben ihrer sonstigen Arbeit alles noch kümmern können. Ich habe dann noch ein bisschen den Musikschülern beim Proben zugehört. Habe gestaunt, dass da ein Polizeiauto mehrmals ganz langsam am Verbindungshaus vorbeifuhr, und mich gefragt, ob die wegen Diekmann da waren oder wegen mir, verwarf den zweiten Gedanken dann aber doch als ein bisschen größenwahnsinnig.
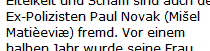
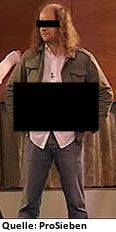 Ach du Schande.
Ach du Schande.