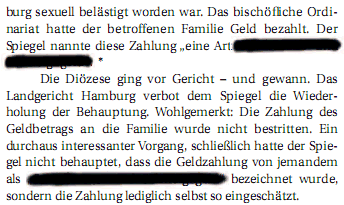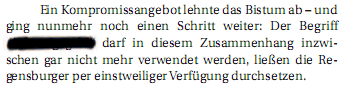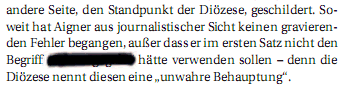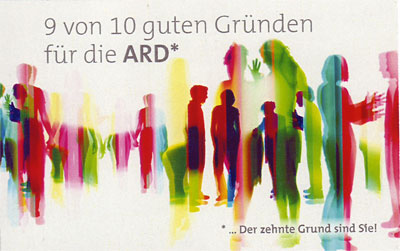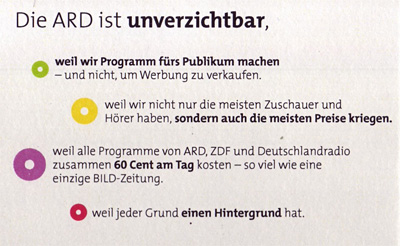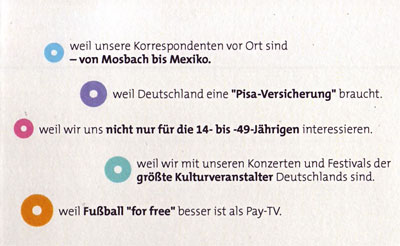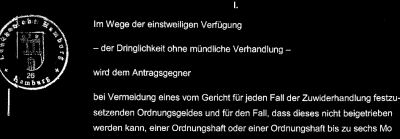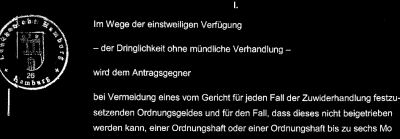
Ich warte auf den Tag, an dem mich jemand verklagt, weil ich ihn klagefreudig genannt habe.
· · ·
Der bekannte Berliner Medienanwalt Christian Schertz möchte nicht mit dem verstorbenen Münchner Rechtsanwalt Günter Werner Freiherr von Gravenreuth verglichen werden. Er meint, dass der Vergleich mit dem als Betrüger verurteilten und für seine umstrittenen Abmahnungen berüchtigten Gravenreuth abwegig ist — das finde ich auch. Und er meint, dass dieser Vergleich deshalb unzulässig ist — das finde ich nicht.
Woher kommt der Gedanke, dass man Dinge, die einem nicht gefallen, mit der Hilfe von Anwälten und Gerichten aus der Welt schaffen lassen kann? Wenn das nicht mit Meinungsfreiheit gemeint ist: dass Leute frei finden und sagen können, an wen ich sie erinnere, egal wie ungerecht mir das erscheinen oder wie unvorteilhaft das für mich sein mag — was denn dann?
Schertz, der sich gerne als Kämpfer für das Gute stilisiert und als Rechtsberater unter anderem die Freiheit der ARD verteidigt hat, einen plumpen Anti-Scientology-Film auszustrahlen, hat in eigener Sache eine besondere Vorstellung von den Grenzen der Meinungsfreiheit. Er hat seinen Dauerfeind, den Gerichtsreporter Rolf Schälike, wegen verschiedener Kommentare hier im Blog abmahnen lassen. Es geht dabei nicht nur um (möglicherweise falsche) Tatsachenbehauptungen. Schälike hatte u.a. kommentiert:
Beide Anwälte [Schertz und Gravenreuth]- der eine post mortal, der andere heute noch – haben einen nachvollziehbaren Grund von der Rechtsprechung enttäuscht zu sein.
Schertz‘ Anwalt forderte deshalb eine Unterlassungserklärung von Schälike:
In diesem Beitrag setzen Sie unseren Mandanten und sein rechtliches Vorgehen mit den Methoden und dem Vorgehen des verstorbenen Rechtsanwalts von Gravenreuth dar [sic]. Dies muss mein Mandant nicht hinnehmen.
Schälike hat mich aufgrund des rechtlichen Vorgehens von Schertz gegen ihn gebeten, alle seine Kommentare unter den entsprechenden Einträgen zu löschen. Doch das ist nicht nur eine Privatfehde. Schertz meint es auch von anderen nicht hinnehmen zu können oder zu müssen, mit Gravenreuth verglichen zu werden.
· · ·
Ich hatte in den vergangenen Wochen mehrfach wieder Kontakt zu dem Anwalt von Stephan Mayerbacher, einem Geschäftsmann aus der Call-TV-Branche, der bereits mehrfach juristisch gegen mich vorgegangen ist. Diesmal bekam ich keine Abmahnungen, sondern wurde „im Guten“ auf Kommentare in diesem Blog hingewiesen, die Herr Mayerbacher für unzulässig hält.
Unter anderem wurde ich aufgefordert, den von einem Kommentator geäußerten Verdacht zu löschen, „Herr Mayerbacher durchsuche Internetforen und -blogs nach abmahnfähigen Beiträgen“, denn das sei unwahr.
Man kann das für eine Form von Ironie halten, wenn jemand seinen Anwalt damit beauftragt, den Betreiber eines Blogs darauf hinzuweisen, dass die Behauptung, er durchsuche Blogs nach abmahnfähigen Beiträgen, abmahnfähig ist. Es ist nur nicht so witzig, so lange man davon ausgehen muss, dass das Hamburger Landgericht darüber nicht lachen kann, sondern im Zweifel einen Beweis dafür will, dass Herr Mayerbacher tatsächlich Blogs und Foren durchsucht und sie nicht vielleicht durchsuchen lässt oder, ganz ohne Suche, zufällig immer wieder auf diese abmahnfähigen Beiträge stößt. Weil ich tatsächlich nicht weiß, was Herr Mayerbacher so in seiner Freizeit macht (aktuell weiß ich nicht einmal, was er beruflich macht), habe ich den entsprechenden Kommentar gelöscht.
Der Anwalt hatte mich auch gebeten, einen Kommentar zu löschen, in dem jemand schreibt, dass Mayerbacher seinen Sitz im Verwaltungsrat des Schweizer Fernsehsenders Star TV „abgegeben hat bzw. abgeben durfte“. Die Formulierung suggeriere, Mayerbacher habe seine Verwaltungsratstätigkeit unfreiwillig aufgegeben, was unwahr sei. Das tut sie meiner Meinung nach nicht, weshalb ich den Kommentar nicht gelöscht habe. Wenn selbst eine solche Formulierung nicht erlaubt wäre, eine bloße Umschreibung des „keine Ahnung, warum der gegangen ist, ob’s freiwillig war?“ schon unzulässig wäre, könnten wir’s wirklich gleich lassen mit der Meinungsfreiheit.
· · ·
Mayerbachers Anwalt sieht in ein paar kryptischen Beiträgen tief in den Kommentarspalten dieses Blogs ein „Kesseltreiben“ gegen seinen Mandanten, das der sich nicht gefallen lassen müsse. Und er fügte den bemerkenswerten Satz hinzu: „Ich sehe auch nicht, worin der Wert für Ihren Blog liegen soll.“
Diese Leute — nicht nur dieser Anwalt oder sein Mandant, sondern viele andere — haben das elementare Prinzip der Meinungsfreiheit nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass sie ein Wert an sich ist. Dass sie auch Beiträge schützt, die nach irgendwelchen subjektiven oder objektiven Maßstäben wertlos sind. Artikel 5, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes lautet nicht: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, solange es sich um ein wichtiges Thema handelt und ein Interesse der Öffentlichkeit an dieser Meinung besteht.“
Man kann diesen Leuten das Missverständnis nicht einmal verübeln, denn die Hamburger und Berliner Gerichte, vor die sie in einer langen Karawane ziehen, um ihre vermeintlichen oder tatsächlichen Ansprüche durchzusetzen, sind dem gleichen Missverständnis erlegen. Seit einigen Wochen haben sie das sogar schwarz auf weiß, formuliert vom Bundesverfassungsgericht. Es erklärte den Berliner Richtern, dass das Persönlichkeitsrecht eines Menschen
seinem Träger keinen Anspruch darauf vermittelt, öffentlich nur so dargestellt zu werden, wie es ihm selbst genehm ist (…).
Das Bundesverfassungsgericht fürchtete,
dass die Gerichte den Schutzbereich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 GG grundlegend verkannt haben. Zwar handelt es sich bei dem — hier als gering erachteten — öffentlichen Informationsinteresse um einen wesentlichen Abwägungsfaktor in Fällen einer Kollision der grundrechtlich geschützten Äußerungsinteressen einerseits und der Persönlichkeitsbelange des von der Äußerung Betroffenen andererseits. Dies bedeutet aber nicht, dass die Meinungsfreiheit nur unter dem Vorbehalt des öffentlichen Interesses geschützt wäre und von dem Grundrechtsträger nur gleichsam treuhänderisch für das demokratisch verfasste Gemeinwesen ausgeübt würde.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte schließlich,
dass die Äußerung wahrer Tatsachen, zumal solcher aus dem Bereich der Sozialsphäre, regelmäßig hingenommen werden muss.
Adressat dieser Grundrechts-Nachhilfe waren formal die Berliner Gerichte, de facto aber auch Christian Schertz, der ursprünglich geklagt und zunächst gewonnen hatte. Auf der langen Liste von Dingen, die er glaubt, trotz Meinungsfreiheit nicht hinnehmen zu müssen, steht nämlich auch das wahrheitsgemäße Zitieren aus einer E-Mail, die er als Antwort auf eine bissige Presseanfrage geschrieben hatte und in der er — wie es seine Art ist — gleich wieder mit juristischen Konsequenzen drohte.
· · ·
Nun ist es eine schöne Sache, dass die obersten deutschen Gerichte der systematischen Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit durch die Hamburger und Berliner Pressekammern zunehmend widersprechen. Aber der Weg zu diesen obersten Gerichten ist weit und teuer.
Ende vergangenen Jahres hat Stephan Mayerbacher beim Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt, die mir praktisch untersagt, eine Verbindung herzustellen zwischen ihm und Vorwürfen, die gegen bestimmte Firmen erhoben werden, für die er in verschiedenen Formen gearbeitet hat. Es bestand aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Auseinandersetzung in letzter Instanz gewinnen könnte. Aber in der ersten und zweiten Instanz in Hamburg waren meine Aussichten gleich null, so dass ich auf den langen, teuren Rechtsstreit (mit natürlich ungewissem Ausgang) verzichtet, den Blogeintrag gelöscht, die einstweilige Verfügung akzeptiert und die Anwalts- und Gerichtskosten von deutlich über 2000 Euro gezahlt habe.
Am ärgerlichsten daran ist, dass das jeden Kommentar zu dem Thema in meinem Blog oder jede künftige Berichterstattung von mir über Mayerbachers Geschäfte äußerst heikel macht. Nicht ohne Grund hängt sein Anwalt an die Mails, die er mir „im Guten“ schickt, immer mal wieder das PDF mit der einstweiligen Verfügung.
· · ·
Nun gibt es sicherlich schwerwiegendere Fälle als die hier genannten, in denen irgendwelche mächtigen oder jedenfalls finanzkräftigen Gruppen oder Unternehmen versuchen, Berichterstattung über sich zu verhindern. Aber gerade die Alltäglichkeit, die Abmahnungen und einstweilige Verfügungen geworden sind, finde ich beunruhigend.
Für erstaunlich viele Menschen, Gruppen und Unternehmen scheint es ganz normaler Bestandteil des Repertoires einer Auseinandersetzung zu sein, anderen ihre Äußerungen zu verbieten. Das ist nicht nur ein juristisches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches und kulturelles.
Ein Beispiel.
Vor kurzem beklagte sich Alexander Görlach in seinem konservativen Online-Magazin „The European“, dass der neue Chefredakteur Michael Naumann das konservative Print-Magazin „Cicero“ nach links rücken wolle. Görlach war früher selbst bei „Cicero“ und schien sehr, sehr aufgeregt über das, was da bei seinem alten Blatt passierte, das offenbar — unbemerkt von der Öffentlichkeit — bislang eines der erfolgreichsten und wichtigsten Medien der Republik war. Die „Cicero“-Mitarbeiter flüchteten massenhaft vor Naumann und seinen linken Meinungsdiktaten, hyperventilierte Görlach: „Cicero ist erledigt.“ Außerdem habe Naumann einen Dienstwagen erwartet, aber keinen bekommen, was sicher irgendwas beweisen sollte.
Naumann antwortete, dass das „alles Quatsch“ sei, sponn, dass das ein „schlechtes Licht auf den Online-Journalismus“ werfe, und widersprach auch der Sache mit dem Dienstwagen. Aber er beließ es nicht dabei. Er schickte über seinen Anwalt auch eine teure Abmahnung. Der „Berliner Zeitung“ erklärte er: „Geht man gegen solche Artikel nicht juristisch vor, bleiben sie ewig an einem hängen.“
Was für ein Irrsinn. Der Artikel auf „The European“ ist zwar jetzt gelöscht. Aber die Zitate aus ihm in den Fachmedien wirken nun viel überzeugender als in ihrem ursprünglichen, von merkwürdiger persönlicher Gekränktheit durchweichten Gesamttext. Glaubt Naumann wirklich, dass die Menschen nun seiner Version der Dinge glauben, weil Görlach eine Unterlassungserklärung unterzeichnet hat? Hat Görlach das getan, weil er eingesehen hat, dass Fakten falsch waren, oder doch nur, weil er eine noch kostspieligere Auseinandersetzung vor Gericht vermeiden wollte?
Naumann glaubt womöglich, dass er den Anwalt einschalten musste, um zu beweisen, dass die Behauptungen wirklich falsch sind. Als würden Anwälte nicht gerade dann gerne eingeschaltet, wenn Behauptungen wahr sind.
Vielleicht wollte er aber auch nur das gute Gefühl haben, jemandem gezeigt zu haben, wo der Hammer hängt. Das ist als psychologisches Moment sicher nicht zu unterschätzen, diese Genugtuung, dass jemand einem schwarz auf weiß gibt, etwas nicht mehr behaupten zu wollen — und dafür sogar Geld zahlen muss.
Zu einer gerichtlichen Entscheidung kam es in diesem Fall gar nicht mehr, weil Görlach die geforderte Unterlassungserklärung abgab. Aber auch die hätte vermutlich keine Klarheit in der Sache gebracht. Natürlich lässt sich so eine einstweilige Verfügung gut verkaufen. Und womöglich gibt es sogar noch zwei, drei Ahnungslose, die glauben, einer solchen Entscheidung läge eine Art Beweisaufnahme zugrunde, in der die Richter gründlich prüfen, womöglich noch Zeugen anhören und dann quasi ein fundiertes, offizielles Urteil darüber abgeben, welche Version der Wahrheit die richtige ist. (So ist es nicht.)
Es ist traurig, das einem alternden Publizisten wie Naumann erklären zu müssen, aber es gibt etwas, das viel überzeugender ist als die (Fehl-)Urteile komischer Richter: Argumente.
Mir will nicht in den Kopf, warum ausgerechnet Journalisten und Medien, die selbst beste Möglichkeiten haben, ihre Widersprüche zur Darstellung anderer zu veröffentlichen, falsche Tatsachenbehauptungen gerade zu rücken und ungerechtfertigte Unterstellungen zu entkräften, glauben, sie müssten zu einem Gericht rennen. Selbst ein Henryk M. Broder, der ein gewaltiges Arsenal sprachlicher Waffen und Knallkörper zur Verfügung hat und auf sein Recht pocht, davon ohne Rücksicht auf Verluste Gebrauch zu machen, hat keine Hemmungen, anderen mit Hilfe von Anwälten und Richtern den Mund verbieten zu wollen.
· · ·
Angenommen, jemand schreibt, „der Niggemeier ist schlimmer als Hitler“. Bestimmt müsste ich das nicht hinnehmen. Aber warum sollte ich dagegen vorgehen? Spricht angesichts eines solchen Vergleichs nicht alles dafür, darauf zu vertrauen, dass auch andere Leute ihn für abwegig halten — und der Vergleich nicht mir schadet, sondern demjenigen, der ihn macht?
Wenn es völlig abwegig ist, die Anwälte Schertz und Gravenreuth miteinander zu vergleichen, muss Schertz nicht dagegen vorgehen. Dadurch, dass er es doch tut, demonstriert er paradoxerweise nicht nur seine Macht, sondern auch fehlendes Selbstbewusstsein. Er könnte den Vergleich sonst einfach aushalten. Oder glaubt er ernsthaft, dass er, sobald er erfolgreich jeden dieser Vergleiche aus dem Internet geklagt hat, von niemandem mehr für so ähnlich wie Gravenreuth gehalten wird? Dass sich Meinungen genauso verbieten lassen wie Meinungsäußerungen? (Ganz abgesehen natürlich von dem schönen Paradoxon, dass er mit jeder dieser Klagen dem Mann ähnlicher scheint, dem er nicht ähnlich sein will.)
Was genau hat sich jemand wie der DFB-Chef Theo Zwanziger davon erhofft, Jens Weinreich zu verklagen, weil der ihn in einem konkreten Zusammenhang als „Demagogen“ bezeichnet hat? Glaubt er, dass seine Kritiker ihn nicht mehr für einen „Demagogen“ halten würden, wenn er ihnen verbietet, ihn öffentlich so zu nennen?
Natürlich schadet es einer Debatte, wenn sie Grenzen überschreitet, wenn Beleidigungen oder Verleumdungen überhand nehmen. Aber im Moment sehe ich unser Diskussionskultur nicht von den Auswüchsen falsch verstandener Meinungsfreiheit bedroht, sondern von den Exzessen einer ausartenden Abmahnunkultur. Im Zweifel ist mir eine Welt lieber, in der zuviel herumkrakeelt wird, als eine, in der jeder damit rechnen muss, dass ihn jedes falsche Wort (und viele wahre) viel Geld kostet.
· · ·
Natürlich gibt es Fälle, in denen es legitim ist oder sogar notwendig sein kann, Veröffentlichungen verbieten zu lassen (und es haben nicht einmal alle dieser Fälle mit der „Bild“-Zeitung zu tun). Aber müsste das in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht das letzte Mittel sein? Eine drastische Maßnahme für besonders drastische Fälle — anstatt ein Routinewerkzeug in jeder Auseinandersetzung? Es ist völlig das Bewusstsein dafür abhanden gekommen, was für ein einschneidender Schritt das ist: jemandem zu verbieten, etwas zu sagen.
· · ·
Vielleicht ist das bei Leuten wie Christian Schertz auch eine berufliche Deformation. Der Anwalt käme gar nicht mehr auf den Gedanken, dass er einer falschen oder irreführenden Aussage einfach widersprechen und damit Menschen überzeugen könnte. Er lässt sie löschen. Sie muss verschwinden, als hätte es sie nie gegeben.
Es geht diesen Leuten nicht mehr darum, sich Gehör zu verschaffen. Es geht ihnen darum, die anderen zum Schweigen zu bringen.
Das ist eine nachvollziehbare Vorgehensweise bei dubiosen Geschäftemachern, deren Abzockmodelle von jeder öffentlichen Debatte über ihre Hintergründe und Funktionsweisen bedroht sind. Für alle anderen müsste sie sich verbieten.
· · ·
Durch den Gang zum Anwalt und zum Gericht wird aus einer Auseinandersetzung um Wahrheit zu einer, in der regelmäßig nicht derjenige gewinnt, der Recht hat, sondern der sich die Auseinandersetzung leisten kann. Der Mächtige gewinnt.
Mich hätte sehr interessiert, wie Springer oder die „Welt“ ihre Abmahnung gegen BILDblog neulich öffentlich begründet hätten. Der Kampf um die Wahrheit oder das Recht auf eine korrekte Darstellung kann es ja nicht sein, dafür hätte es ein Anruf oder eine E-Mail getan. Natürlich war das eine reine Machtdemonstration.
Und so wunderbar es ist, dass unsere Leser uns in einem solchen Maß unterstützt haben, dass uns auch vor weiteren Machtdemonstrationen erst einmal nicht bange sein muss, und so sehr ich mich freue, dass auch Stefan Aigner von regensburg-digital.de für seinen Kampf gegen das Bistum Regensburg viele Tausend Euro bekommen hat — das kann es doch auf Dauer nicht sein, dass die Blogger und ihre Fans und Leser diesen Wahn auch noch selbst finanzieren.
· · ·
Dieser Text hat keinen Schluss. Das liegt daran, dass er in den nächsten Tagen weiter geht.
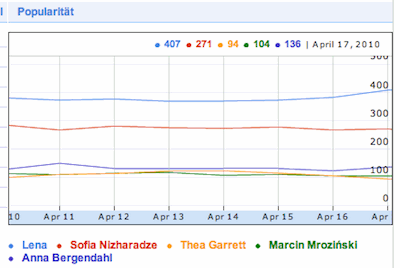
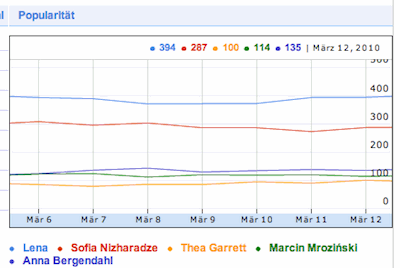
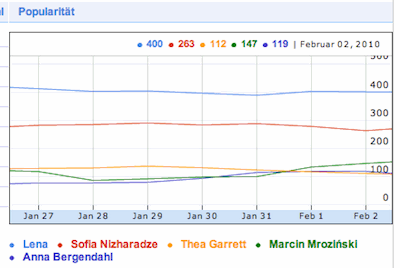
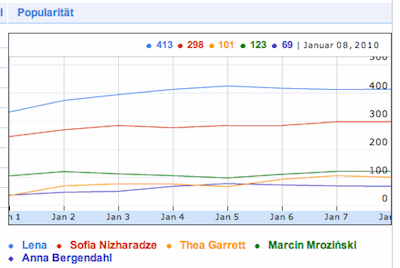
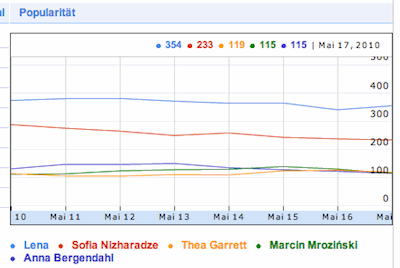

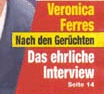 Das „ehrliche Interview“ mit Veronica Ferres, das die „Aktuelle“ auf dem Cover verspricht, entpuppt sich als ein Text, den sich die Redaktion aus Versatzstücken eines
Das „ehrliche Interview“ mit Veronica Ferres, das die „Aktuelle“ auf dem Cover verspricht, entpuppt sich als ein Text, den sich die Redaktion aus Versatzstücken eines 

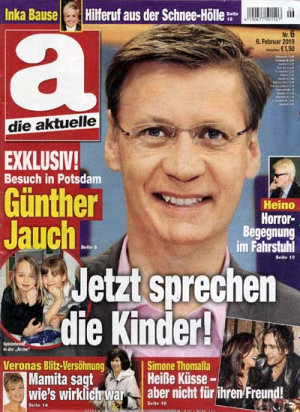

 Hoffmann schreibt jedenfalls:
Hoffmann schreibt jedenfalls: