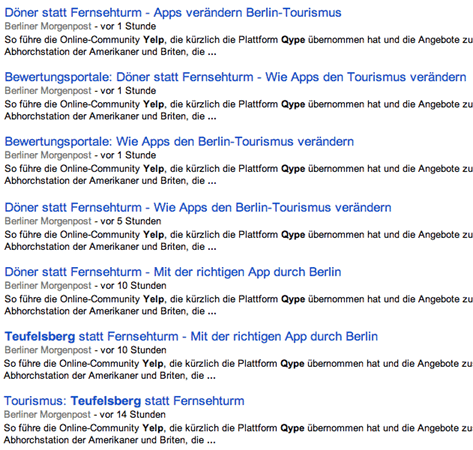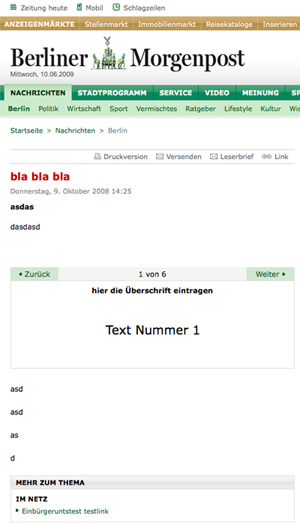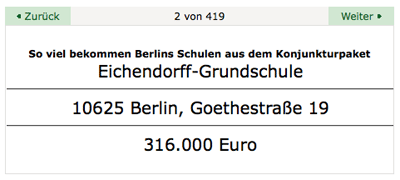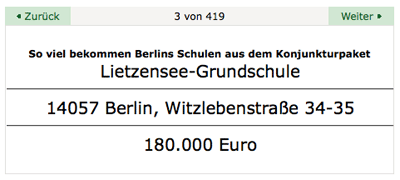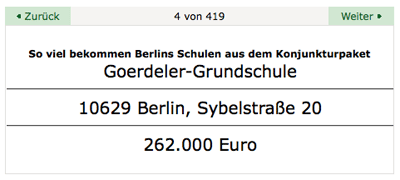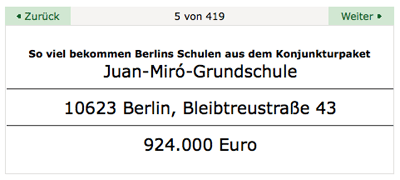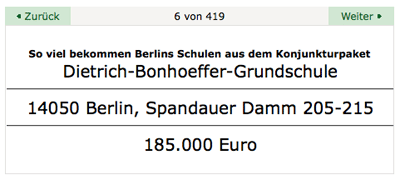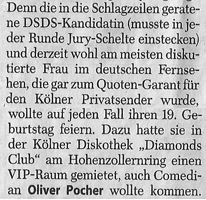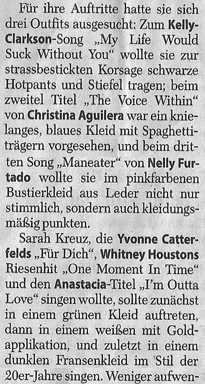Einer der erstaunlichsten Sätze zum Quasi-Abschied der Axel Springer AG aus dem Zeitungs- und Zeitschriftengeschäft steht auf den Seiten des unaussprechlichen „Think Tanks zur Medienkritik“ namens „Vocer“. Janko Tietz schreibt dort, der Verkauf der diversen Print-Produkte werde sich für Springer rächen. Es sei nämlich ein Irrglaube, dass das Geschäft mit gedruckten Medien tot sei. Dann folgt der Satz:
Auch in zwanzig Jahren werden die Menschen noch Zeitung lesen, werden sich in ihren Regionalausgaben informieren, welcher Eckladen schließt, wie die Öffnungszeiten des Freibades sind, welcher Künstler in der Stadt auftritt.
Wer behauptet zu wissen, wie die Menschen in zwanzig Jahren Medien nutzen werden, muss ziemlich bekloppt oder größenwahnsinnig sein. Aber ich halte den Satz nicht nur als Prognose für die Zukunft gewagt, sondern auch als Beschreibung der Gegenwart.
Ich lebe in Friedrichshain, einem Berliner Ortsteil mit 120.000 Einwohnern. Es gibt für diese Menschen de facto keinen Lokaljournalismus.
„Berliner Morgenpost“, „Berliner Zeitung“, „Tagesspiegel“ und „taz“, „B.Z.“ und „Berliner Kurier“, sie alle haben zwar den Anspruch, über das zu berichten, was in Berlin passiert. Aber das ist in aller Regel Regionalberichterstattung: Es geht politisch um den Regierenden Bürgermeister, den Senat und das Abgeordnetenhaus, inhaltlich um Themen wie den Schloss-Neubau, den neuen Flughafen, die BVG. Was in den einzelnen Bezirken passiert, Gebieten mit mehr Einwohnern als die meisten Großstädte, kommt hier nur in kurzen Notizen oder zufälligen Schlaglichtern vor. Von meinem persönlichen Kiez mit den gefühlt stündlich wechselnden Eckläden ganz zu schweigen.

Reden wir nicht von Eckläden und Freibädern. Reden wir von einer gewaltigen Brachfläche, deren Bebauung den zukünftigen Charakter der Gegend, in der ich lebe, entscheidend beeinflussen wird. Es handelt sich um den Block 74, das sogenannte Freudenberg-Areal, benannt nach der Firma, die hier bis vor wenigen Jahren angesiedelt war. Das Gelände ist 26.000 Quadratmeter groß, nun sollen hier 550 Wohnungen entstehen. So will es der Investor; einer Gruppe von Anwohnern ist das viel zu viel.
Es gibt heftige Diskussionen, lautstarke Bürgerversammlungen, überzeugende und weniger überzeugende Versuche, die Anwohner in die Planungen einzubeziehen, Kompromissvorschläge.
Was es nicht gibt: eine kontinuierliche Berichterstattung über all das in der Zeitung.
Im Januar war ich bei einer Versammlung in der Aula der Grundschule. Die über 200 Anwohner fanden kaum alle Platz. Sie stritten mit dem Investor und dem Bezirksbürgermeister, forderten größere Grünflächen und mehr erschwingliche Wohnungen, ließen sich die aktuellen Pläne und die echten oder vermeintlichen Zugeständnisse erklären.
Nur die „taz“ berichtete zwei Tage später über die Veranstaltung, in einem ausführlichen und grundsätzlichen Bericht. Im Mai gab es, ebenfalls in der „taz“, einen Artikel über die weiteren Entwicklungen. Die anderen Tageszeitungen haben in diesem Jahr noch nicht über dieses für Friedrichshain entscheidende Bauprojekt und die Diskussionen darum berichtet.
Womöglich werden sie das irgendwann wieder tun. Der „Tagesspiegel“ zum Beispiel hatte Ende vergangenen Jahres einen größeren Artikel. Aber ist das die Idee einer Lokalzeitung, dass ich sie Tag für Tag kaufen soll, in der Hoffnung, dass irgendwann, vielleicht nach Wochen, etwas Relevantes aus meiner Umgebung darin steht?
Ich weiß nicht, wie typisch Berlin ist. Aber ich möchte behaupten, dass in dieser Stadt auch heute schon die Menschen nicht Zeitung lesen, um sich zu informieren, welcher Eckladen schließt, schon deshalb, weil ihre Zeitung sie nicht darüber informiert, welcher Eckladen schließt.
Zu einem gewissen Anteil haben diese Aufgabe immerhin noch die Anzeigenblätter „Berliner Woche“ (Springer) und „Berliner Abendblatt“ (Dumont Schauberg) übernommen. Aber die Redaktion des „Berliner Abendblattes“ wurde im vergangenen Jahr komplett entlassen, und ich bin mir nicht sicher, ob Janko Tietz mit seinem Postulat vom dauerhaften Bestand des gedruckten Lokaljournalismus ausgerechnet auf das berufen wollte, was kostenlose Anzeigenblätter darunter verstehen.
Und sollte die Zukunft der Tageszeitung wirklich davon abhängen, dass es auf Dauer genug Menschen gibt, die die Öffnungszeiten des Freibades oder die Auftrittsdaten von Künstlern zuhause auf Papier nachlesen wollen? — Informationen, für die es, egal ob sie nun umständlich gedruckt und durchs Land gekarrt werden oder nicht, jedenfalls keine Journalisten braucht, um sie zusammenzutragen.
Den beiden Berliner Stadtmagazinen „Tip“ und „Zitty“ geht es übrigens miserabel. Der Berliner Verlag hat den „Tip“ gerade an eine kleine Servicejournalismus-Agentur verkauft.
Ich wünschte mir, es gäbe dort, wo ich lebe, einen Lokaljournalismus, der diesen Namen verdient. Vielleicht wird irgendwann jemand kommen, der es versucht. Mein Tipp wäre aber eher, dass es ein Online-Projekt wird, ähnlich wie es die „Prenzlauer Berg Nachrichten“ versuchen.
Der Gedanke, dass Zeitungen schon deshalb nicht sterben werden, weil in ihnen steht, was mich angeht, weil es in meiner Nachbarschaft passiert, erscheint jedenfalls aus der Perspektive eines Bewohners von Berlin-Friedrichshain doppelt weltfremd.
In Berlin wurden 2010 pro 100 Einwohner 26 Zeitungen verkauft. Zwei Jahre später waren es noch 23,3. Wenn es eine Hoffnung für lokale Tageszeitungen gibt — hier lebt sie nicht.