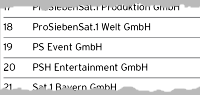Fotos: Sat.1/ProSieben/Willi Weber
War ja klar. Wenn ich schon mal vorab groß über eine neue Show schreibe, weil ich das Konzept faszinierend finde und mich über den Mut freue, es auszuprobieren, wird es ein Desaster. Mitte Dezember war ich in Köln, um mit Karsten Dusse, dem Erfinder der „Millionärswahl“, zu sprechen. Geredet hat aber vor allem Jörg Grabosch, der Chef der Produktionsfirma Brainpool. Fast zwei Stunden lang sprudelte es aus ihm heraus. Er war so begeistert von dem simplen Konzept, einen Millionär vom Publikum wählen zu lassen, und aufgeregt, wie man daraus eine gute Show machen kann, wenn nicht Redakteure die Teilnehmer und Inhalte bestimmen, sondern eine Community im Internet.
Die beiden haben mir die Tafel gezeigt, auf der sie versucht haben, aus den 49 sehr unterschiedlichen Kandidaten sieben abwechslungsreiche Shows zu komponieren. Sie haben mir die ersten Vorstellungs-Einspielfilme gezeigt, die versuchten, aus den Internet-Videos der Leute professionell wirkende Fernseh-Trailer zu machen. Sie haben mir von der „Convention“ erzählt, zu der sie alle 49 nach Köln eingeladen haben, damit sie dort gefilmt, fotografiert und interviewt werden, weil die Zeit gar nicht ausgereicht hätte, die alle zuhause zu besuchen. Über Weihnachten und Silvester haben die besten Leute bei Brainpool an dieser Show gearbeitet.
Es war leider trotzdem keine gute Show.

Ich glaube, der Hauptfehler war, aus dem Konzept der Millionärswahl eine große Show zu machen, in der Leute live auf der großen Bühne etwas vorführen. Die meisten Kandidaten, die ins Fernsehen gewählt wurden, hatten irgendwelche Talente und konnten etwas ganz gut. Da war eine Frau, die ganz gut mit einem Ball umgehen kann, eine Gruppe junger Männer, die ganz gut turnen kann, ein Motocross-Fahrer, der ganz gut Freestyle-Sprünge kann, ein Sänger und Musiker, der, naja.
Viele dieser Leute waren nicht schlecht. Aber keiner war so gut, dass man sagte: Wow, für die Leistung hätte er eine Million Euro verdient.
Vielleicht hätte man anders geurteilt, wenn man die Leute gekannt hätte. Wenn man mehr über ihre Geschichte und Geschichten erfahren hätte. Wenn man das Besondere an den Persönlichkeiten kennengelernt hätte.

„Wem gönnst du die Million“, lautete die Frage, die die Show stellen wollte und die ich nach wie vor für faszinierend halte. Tatsächlich war sie aber so sehr auf die Performance auf der Bühne ausgelegt, dass es in der Sendung mehr klang nach: „Was muss jemand können oder machen, dass er dafür eine Million verdient hätte.“ Die Antwort lautet dann in den meisten Fällen schnell: Keine Ahnung, aber mehr als das.
Es hätte, anders gesagt, eine Gesprächssendung sein müssen, mit dafür geeigneten Moderatoren und einem passenden Rahmen, ohne das LED-Ufo-Getöse mitten im Raum. Aber das wäre dann vermutlich keine mehrstündige 20-Uhr-15-Show für ProSiebenSat.1 geworden. (Gut, so war sie es, wie sich dann herausstellte, auch nicht.)
Die Nähe in der Inszenierung zu den vielen bekannten Casting- und Dinge-um-die-Wette-Mach-Shows schadete der „Millionärswahl“. Es hätte sehr geholfen, wenn es mehr Kandidaten in die Sendung geschafft hätten, die nicht mit ihrem Talent oder ihrer Persönlichkeit, sondern eine tollen Idee zur Verwendung des Geldes angetreten wären. Die eine genaue Vorstellung hätten, was sie mit dem Gewinn anstellen wollen: Filmstudenten oder Erfinder, zum Beispiel, so dass alle etwas davon haben, wenn einer von ihnen die Million bekommt. Aber die haben sich kaum beworben. Und wenn sie es getan hätten, weiß man auch nicht, ob die Show-Firma Brainpool es geschafft hätte, sie und ihre Ideen in diesem Rahmen ansprechend in Szene zu setzen.
Womöglich wären auch die Reaktionen auf den Überraschungssieger der ersten Sendung nicht so heftig ausgefallen, wenn man mehr ihn über sein Projekt — eine Tanzschule für Kinder — erfahren hätte. Vielleicht hätte sich dadurch erklären lassen, warum die anderen Kandidaten, die ihn kannten, ihm so viele Punkte gaben, dass er gewann, obwohl das Publikum nicht für ihn gestimmt hatte. Die Zuschauer hatten vor allem seine Performance auf der Bühne gesehen, und die war jetzt nicht so spektakulär.

Ach, und das Voting. Es war kein Versehen, dass die Kandidaten in der ersten Show mit ihrem Voting das Feld noch komplett durcheinander würfeln konnten. Dass die Punkte, die sie vergaben, die Entscheidung brachten und dass die im Angesicht der Punkte gefällt wurde, die vorher schon abgegeben worden waren. Grabosch hat mir mehrmals stolz vorgerechnet, wie diese 28 Punkte der Teilnehmer untereinander am Schluss alles noch drehen können.
Das Publikum fand das aber offenkundig nicht aufregend und fasznierend, sondern empörend — angesichts des speziellen zufälligen Verlaufs der Punktevergabe war das sehr nachvollziehbar und führte vermutlich zu der Regeländerung in der zweiten Sendung.
Solche Dinge passieren, wenn man kein fertiges und im Ausland vielfach getestetes Format einkauft, sondern eine eigene Idee hat und daraus eine Show bastelt. Fernsehkritiker fordern die ganze Zeit, dass das deutsche Fernsehen nicht immer auf Nummer sicher gehen und auch einmal etwas wagen soll. Wer viel wagt, kann so richtig spektakulär scheitern.
Die „Millionärswahl“ war keine gute Show, und insofern ist es natürlich in Ordnung, dass das Publikum sie nicht eingeschaltet hat, und konsequent, dass ProSieben und Sat.1 nun mit drastischen Schritten Schadensbegrenzung versuchen. Blöd ist das aber nicht nur für die Möchtegernmillionäre, die sich auf einen großen Auftritt gefreut hatten, der sich für viele auch ohne den Gewinn gelohnt hätte. Blöd ist es auch für das deutsche Fernsehen. Zu fürchten ist nämlich, dass die Sender, und insbesondere die renditefixierte Gruppe ProSiebenSat.1, in Zukunft noch mehr auf Nummer sicher gehen und das Risiko des Neuen, Kreativen, Unerprobten meiden.

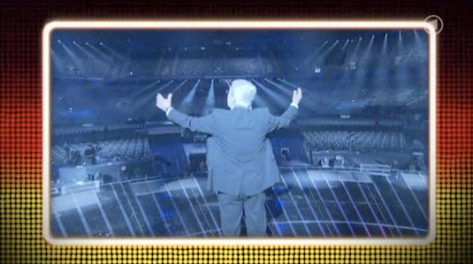


 Man tut Fernsehsendern manchmal Unrecht. Dass diese Wok-WM, die Stefan Raab seit vier Jahren veranstaltet, randvollgestopft ist mit Werbung — das darf man wirklich nicht Pro Sieben in die Schuhe schieben. Denn Pro Sieben veranstaltet die Wok-WM nicht, sondern überträgt die Sendung nur. Pro Sieben wird diese Werbung auf den Leibchen, den Geräten, den Kulissen und in den Namen der teilnehmenden Teams, nur „aufgedrängt“, wie der Sender gegenüber epd Medien erklärte.
Man tut Fernsehsendern manchmal Unrecht. Dass diese Wok-WM, die Stefan Raab seit vier Jahren veranstaltet, randvollgestopft ist mit Werbung — das darf man wirklich nicht Pro Sieben in die Schuhe schieben. Denn Pro Sieben veranstaltet die Wok-WM nicht, sondern überträgt die Sendung nur. Pro Sieben wird diese Werbung auf den Leibchen, den Geräten, den Kulissen und in den Namen der teilnehmenden Teams, nur „aufgedrängt“, wie der Sender gegenüber epd Medien erklärte.