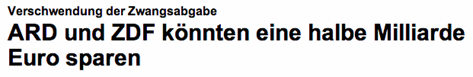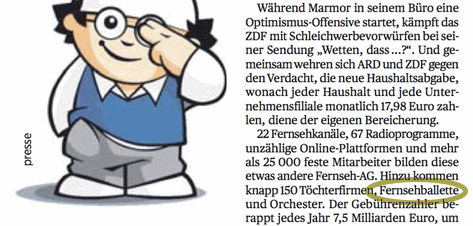Morgen entscheiden die Ministerpräsidenten, was mit den überschüssigen Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag passieren soll. Nach der Umstellung auf die Haushaltsabgabe wurde viel mehr Geld eingenommen, als dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusteht.
Sechs Verbände von Schauspielern, Drehbuchautoren, Filmschaffenden und Produzenten haben heute einen Vorschlag gemacht: Rund 100 Millionen von dem zuviel eingenommenen Geld sollen ARD und ZDF behalten dürfen, um damit besseres Programm zu machen.
Gut, eigentlich sollen ARD und ZDF das Geld natürlich den Schauspielern, Drehbuchautoren, Filmschaffenden und Produzenten geben, damit die damit ein besseres Programm machen können. Es ist insofern ein leicht durchschaubares, aber völlig legitimes Werben in eigener Sache. Aber die Argumentation dahinter ist von rührender Naivität.
In der gemeinsamen Presseerklärung heißt es:
Die Produzentenallianz und verschiedene Kreativen-Verbände haben sich in mehreren Stellungnahmen dafür ausgesprochen, jedenfalls Teile der zu erwartenden Überschüsse zu nutzen, um ARD und ZDF in die Lage zu versetzen, eine Programmoffensive zu starten (…).
Ahem. Wenn die Sender statt, grob gerechnet, 8 Milliarden Euro 8,1 Milliarden Euro zur Verfügung hätten, dann wären sie plötzlich „in der Lage“, eine Programmoffensive zu starten? Mit all den tollen innovativen Sendungen, die bislang irgendwie nur das Ausland hinkriegt?
Ja, genau so stellen sich das die Filmverbände vor:
Eine solche Programm-Initiative würde es beiden Sendern ermöglichen, vermehrt Programme in Auftrag zu geben, die international Qualitätsstandards setzen und die mit Produktionsbudgets ausgestattet wären, welche es den Produzenten ermöglichen, den Kreativen und den Filmschaffenden Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu bieten, die der hohen Qualität ihrer Leistungen entsprechen.
Und dann gibt es endlich auch ein deutsches „House of Cards“, ein deutsches „Homeland“, ein deutsches „Downton Abbey“, ein deutsches „Borgen“? Genau:
Die Mittelkürzungen in den Programmetats von ARD und ZDF sind eine Ursache dafür, dass die heute international anerkannten Programmideen nicht mehr aus Deutschland kommen. Hier sind etwa die TV Serien („House of Cards“, „Homeland“, „Downton Abbey“, „Borgen“ etc.) zu nennen, die weltweit — und auch in Deutschland — wegen der Qualität und Sorgfalt, mit der sie produziert wurden, Anerkennung finden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Produzenten mit „nicht mehr“ meinen. Welche frühere international anerkannte Programmidee kam denn aus Deutschland? Okay, „Derrick“.
Die Bedingungen, unter denen in Deutschland Fernsehen entsteht, sind sicher schwieriger geworden; Etats, Drehtage, Gagen schrumpfen. Der Anspruch an ARD und ZDF, Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen hochwertiges, auch innovatives Fernsehen entstehen kann, ist absolut berechtigt. Das ist ihr Auftrag.
Aber was für ein absurder Gedanke, dass dieser Auftrag nicht mit 8 Milliarden Euro erfüllt werden könnte. Oder wenn er nicht mit 8 Milliarden Euro erfüllt werden kann, dass er mit 8,1 Milliarden Euro erfüllt würde.
Ich bin prinzipiell ein Freund des dualen Systems und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Finanzierung durch die Allgemeinheit (obwohl mir die Programme von ARD und ZDF zunehmend Probleme bereiten, das zu begründen). Aber die Idee, dass man den Sendern zusätzlich Geld geben müsste, damit sie herausragendes Fernsehen machen, ist komplett abwegig.
Es ist eine Frage des Wollens. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und es ist eine Frage der Senderkultur. Man kann das am Beispiel des dänischen Fernsehens nachlesen, dass deren besonderen, hochwertigen, erfolgreichen Produktionen eben in einem besonderen Umfeld entstanden sind, mit Menschen, die eine Vorstellung von dem hatten, was sie tun wollten, mit einem Sender, der sich seines besonderen Auftrages bewusst war, mit einer Kultur, in der nicht Angst und Risikovermeidung und Quotenfixierung herrscht, sondern die Kreativität ermöglicht, Freiräume schafft, Talente fördert.
Es stimmt schon, dass Geld dabei auch hilft, aber so sehr es in den Sendern aufgrund der eher sinkenden Programmbudgets an einigen Stellen empfindlich kneifen mag, kann doch niemand ernsthaft behaupten, dass es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland insgesamt an Mitteln fehlt.
(Und, wie gesagt, das schreibe ich als einer von gefühlt gar nicht so vielen Menschen, die ARD und ZDF das Geld, das sie jetzt bekommen, noch verhältnismäßig gern zugestehen und sie nicht auf irgendwelche Schwarzbrot- oder Pay-TV-Programme reduzieren wollen. Zur vor-vor-(vor?)-letzten Gebührenerhöhung hab ich noch in der FAS einen Artikel mit der Überschrift „Gebt’s ihnen“ geschrieben. So einer bin ich.)
Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat vorgeschlagen, den Rundfunkbeitrag um 73 Cent zu senken. Das entspricht der Hälfte des Betrags, der nach ihren Schätzungen gerade zuviel eingenommen wird. Die andere Hälfte soll zurückgelegt werden, für den Fall, dass sich diese Schätzungen als falsch herausstellen, und als Puffer, damit der Beitrag dann nicht sofort wieder erhöht werden muss.
Ich bin sehr für diese Senkung, weil genau das immer die Geschäftsgrundlage für die Umstellung der Rundfunkgebühren war: Wenn dadurch mehr eingenommen wird, bekommen die Bürger das zurück. Das war auch ein entscheidendes Argument, den hysterischen Medienberichten der vergangenen Jahre zu widersprechen, die immer neue, immer höhere Prognosen brachten, wie viel Mehreinnahmen zustande kommen könnten: Dass sich das Geld, das ARD und ZDF bekommen, nicht danach richtet, wieviel eingenommen wird, sondern danach, was sie brauchen und ihnen von der KEF zugestanden wird. Dass man erbittert darüber streiten kann, wie viel das sein sollte, liegt in der Natur der Sache. Aber dieses Prinzip jetzt in Frage zu stellen, wäre falsch und ein gefährliches Signal an die rundfunksbeitragsskeptischen Rundfunkbeitragszahler.
Mögen die 73 Cent auch läppisch wirken: Die Reduzierung wäre ein klares Zeichen und eine vertrauensbildende Maßnahme. Und die Kreativen müssen das Geld, das sie brauchen, um bessere oder wenigstens besser bezahlte Arbeit zu machen, aus dem bestehenden Etat heraus verhandeln. Hilft alles nix.