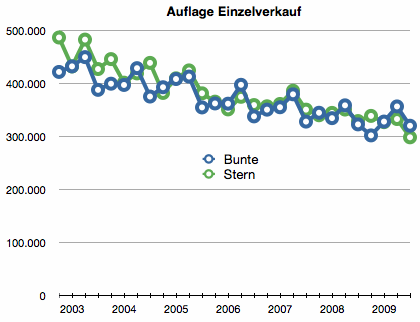Auf den ersten Blick ist es leicht, stern.de mit dem hochwertigen journalistischen Angebot zu verwechseln, als das es sich ausgibt. Auf der Startseite verbinden Fotos aktuelle Themen zu großen Blöcken; im Inneren sprudeln rund um die Uhr die Nachrichten.
Der Verlag Gruner+Jahr nennt stern.de „eine Art ‚Antwortmaschine‘ von Menschen für Menschen. Alle Nachrichten werden auf ihre Bedeutung für den User fokussiert und mit weiterführenden multimedialen Inhalten verlinkt“. Der Werbevermarkter ems schreibt, stern.de richte sich „an alle, die aktuelle Themen nicht nur wissen, sondern deren Bedeutung für ihr Leben verstehen wollen“. Chefredakteur Frank Thomsen zählt seine Seite zur „Spitzengruppe“ der „News-Websites“.
Nun.
367 Artikel hat stern.de gestern veröffentlicht. Knapp 300 davon sind Agenturmeldungen, die vollautomatisch in den „Nachrichtenticker“ von stern.de einfließen. Es verbleiben 76 Artikel (Übersicht).
Davon sind:
- 33 Text-Meldungen von Nachrichtenagenturen
- 23 Videos der Nachrichtenagentur Reuters
- 4 Promotion-Artikel für „Stern-TV“
- 3 Übernahmen aus anderen Medien (RTL, „Finanztest“, FTD)
- 5 Bilder-Galerien
Es verbleiben:
- 8 Eigenberichte
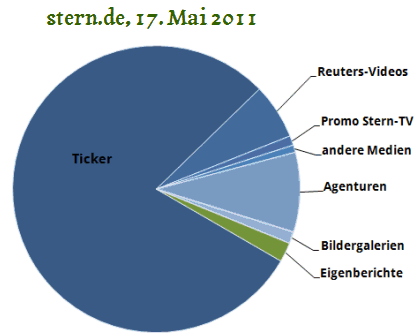
Die mehr oder weniger eigenen Berichte sind:
- Söhne Mannheims: „Es wäre viel einfacher, über Satanismus zu singen“ (Stern.de digital TV)
- Streit um Bundeswehrreform: Guttenberg hinterließ nur Chaos (Hans Peter Schütz)
- Kopfwelten zur Affäre Strauss-Kahn: Macht kennt keine Regeln (Frank Ochmann; wöchentliche Kolumne)
- Vergewaltigungsvorwürfe gegen IWF-Chef: Der Fall Strauss-Kahn – die wichtigsten Fakten (Niels Kruse, dpa, AFP)
- Blog Cafè au Lait: Mitter…äh…Museumsnacht in Paris… (Lisa Louis; Blog)
- Neue Gepäckregeln bei Lufthansa: Nur noch der erste Koffer fliegt gratis (Till Bartels)
- Frau fotografierte US-Raumfähre: Hier zischt die „Endeavour“ ab
- Kritik an Vogelruf-Apps: Wenn im Wald die Smartphones zwitschern (Christoph Fröhlich)
(Christoph Fröhlich)
Davon müsste man jetzt, streng genommen, noch den Artikel über die neuen Gepäckregeln bei der Lufthansa abziehen, der vor allem aus der — teils wörtlichen — Übernahme einer Lufthansa-Pressemitteilung besteht.
Die eigene journalistische Leistung von stern.de bestand gestern also im Wesentlichen aus einem Videointerview mit den Söhnen Mannheims, einem Stück über die Bundeswehrreform und einem Artikel über Kritik an Vogelruf-Apps.
Nun steckt natürlich auch in den Agenturmeldungen, die stern.de nicht bloß in den Nachrichtenticker fließen lässt, Arbeit. Die Redaktion redigiert oder kürzt sie, baut Links zu eigenen Seiten und Quellen ein und denkt sich gelegentlich originelle Überschriften aus. Die Meldung, dass sich Xavier Naidoo keinen Stadtplan auf seinen Rücken tätowieren lassen will, betitelt sie: „Xavier Naidoo: Ein Stadtplan auf dem Rücken“.
Das war an einem zufälligen Tag (gestern) das Internetangebot des „Stern“: Knapp sieben eigene Artikel und fünf Bildergalerien, angereichert mit Hunderten von Agenturen eingekauften Meldungen, die exakt oder annähernd wortgleich überall sonst stehen.
Das Online-Angebot des „Stern“ hat sich in den vergangenen Jahren von einem großen Teil seiner Mitarbeiter und ungefähr jedem inhaltlichen Anspruch verabschiedet. Als nicht mehr genug Leute da waren, um damit die acht Textressorts zu füllen, löste man die Ressorts auf. Unter den Namen „Projekt Blau“ wurde das zur strategischen Entscheidung verbrämt. Seitdem gibt es nur noch die Ressorts Nachrichten und Wissen — sowie anscheinend eine Stabsstelle, die sich überraschend Formulierungen über die Arbeitsweise der Redaktion ausdenkt, die weitestmöglich von der Realität entfernt sind. So sagte Frank Thomsen im vergangenen Jahr im Braanchendienst „Meedia“:
Wir wollen künftig mutiger auswählen, entschiedener im Umgang mit den News sein. Wir werden uns redaktionell auf die Topthemen konzentrieren und dazu mehr und vertiefende Inhalte anbieten. (…) Der Grundgedanke lautet: mehr in die Tiefe als in die Breite denken und lieber am Rand etwas weglassen. Austauschbare Nachrichten gibt es genug. (…) Wir setzen auf die großen Themen, hier wollen wir Fachkompetenzen bündeln.
Das wäre eigentlich ein treffender Werbeslogan für stern.de: „Austauschbare Nachrichten gibt es genug, und bei uns stehen sie alle!“
Dass auf stern.de praktisch keine wertvollen Inhalte stehen, ist kein Versehen, sondern Absicht. Beim „Stern“ ist man überzeugt, dass das das Schlimmste wäre, das man tun könnte: Dinge mit Wert für den Nutzer kostenlos abgeben. Deshalb finden sich praktisch keine Inhalte aus der Zeitschrift auf stern.de. Und deshalb lassen sich die meisten „Stern“-Redakteure auch nicht dazu herab, für stern.de zu schreiben.
Erstaunlicherweise nennt stern.de-Chefredakteur Frank Thomsen sein Angebot dennoch ein „modernes journalistisches Angebot, das u.a. junge Zielgruppen an die Marke stern bindet und das Geld verdienen soll“. Woher Menschen, die Medien eher im Internet als auf Papier konsumieren, ahnen sollen, dass es sich beim „Stern“ nicht um eine Illustrierte handelt, in der eine Agenturmeldung an die andere gereiht wird, bleibt bei diesem Vorgehen, das man nicht einmal euphemistsich „Strategie“ nennen möchte, natürlich offen.
Das Online-Angebot des „Stern“ ist die Antwort des Verlags Gruner+Jahr auf die Frage: Was machen wir im Internet, wenn wir nichts im Internet machen wollen? Es ist der Versuch, mit überwiegend eingekauftem Allerweltsmaterial durch geschickte Verpackung ein eigenständiges Medium zu simulieren. Relevanz ist dabei verzichtbar, solange die Reichweite stimmt.
Und tatsächlich steigen gerade die Besucherzahlen von stern.de. Es ist der Rumpfproduktion offenbar gelungen, ihren aufgemotzten Agenturticker so zu präsentieren, dass er von Google und vielen Lesern tatsächlich versehentlich für ein eigenständiges journalistisches Angebot gehalten wird. Man muss sie für diesen Erfolg bemitleiden.
Nachtrag / Korrektur 18:35 Uhr. Ich hatte einen Artikel übersehen. Eine ganz exakte Zählung ist allerdings auch deshalb schwierig, weil stern.de das Veröffentlichungsdatum teilweise nachträglich zu ändern scheint.