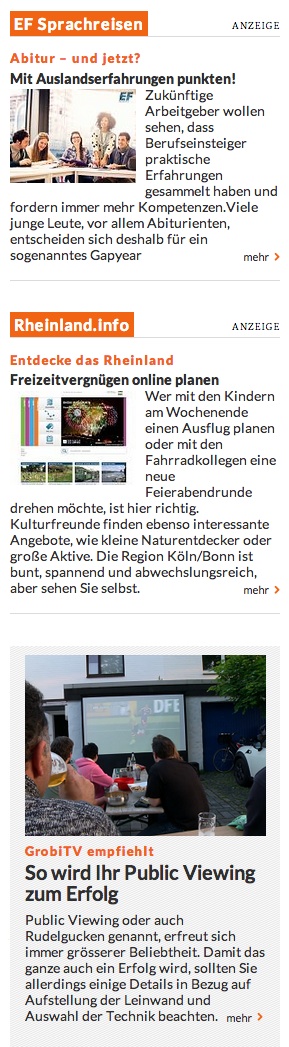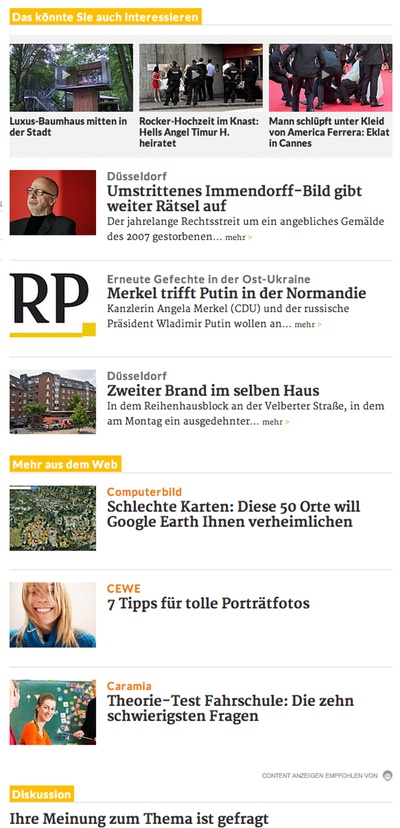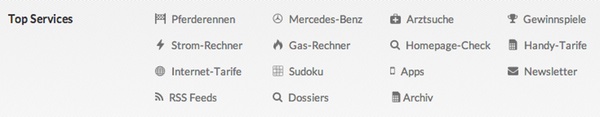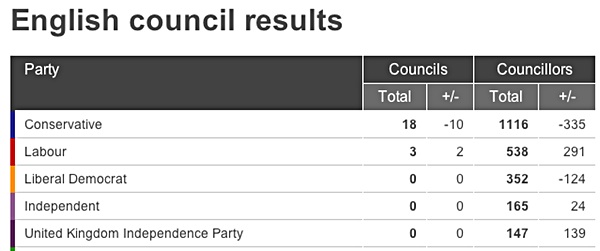Christian Wulff musste aufgrund einer Falschmeldung der „Bild“-Zeitung als Bundespräsident zurücktreten. Es ist erstaunlich, wie wenig das bekannt ist und wie wenig das die Leute zu stören scheint.
Wulff trat am 17. Februar 2012 zurück, weil die Staatsanwaltschaft Hannover ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete. Ausschlaggebend dafür waren, wie der Celler Generalstaatsanwalt Frank Lüttig später der „Welt am Sonntag“ sagte, Presseberichte, wonach Wulffs Freund David Groenewold versucht habe, „Beweise aus der Welt zu schaffen“. Berichtet hatte das die „Bild“-Zeitung am 8. Februar 2012. Doch deren Behauptungen und Mutmaßungen waren falsch und sind längst gerichtlich untersagt.
· · ·
Am Ende von Wulffs Amtszeit steht ein Skandal. Es ist ein Medien-Skandal.
Der „Bild“-Artikel, der zum Rücktritt des Bundespräsidenten führte, trug die Überschrift:

Es geht um einen Urlaub, den die Eheleute Wulff im Herbst 2007 mit Groenewold im Hotel Stadt Hamburg auf Sylt verbrachten. Groenewold hatte die Reise organisiert und vorab bezahlt. Wulff sagt, er habe Groenewold Auslagen vor Ort in bar beglichen.
Das war nicht neu. Das hatte der NDR schon Wochen vorher berichtet; Groenewold hatte dem Sender damals entsprechend Auskunft gegeben. „Bild“ wurde die Behauptung, diesen Sachverhalt „enthüllt“ zu haben, später gerichtlich untersagt.
Neu war aber der Vorwurf der versuchten Vertuschung.
Anfang Januar, so „Bild“, hätte Groenewold beim Hotel angerufen und die Angestellten aufgefordert, „keinerlei Infos über ihn“ und den gemeinsamen Urlaub herauszugeben. „Falls also Bild oder Spiegel anruft, wir wissen von nichts!“, habe das Hotel notiert.
Wenige Tage später habe sich Groenewold erneut im Hotel einquartiert und Mitarbeiter des Hotels aufgefordert,
relevante Rechnungen und Belege aus dem gemeinsamen Kurzurlaub mit dem Ehepaar Wulff aus dem Jahr 2007 auszuhändigen. Ein Hotel-Manager übergibt Groenewold Anreiselisten, Meldescheine und Verzehrquittungen.
Um der Geschichte die nötige Wucht zu geben, suchte und fand das Blatt vor der Veröffentlichung Menschen, die den „Bild“-Recherchen blind vertrauten und sie in gewünschter Form kommentierten. Zwei führende niedersächsische Oppositions-Politiker ließen einspannen, und so konnte „Bild“ noch in dem Artikel mit der vermeintlichen Enthüllung melden:
Die Opposition wittert jetzt „Versuche, Akten zu säubern“. (…)
Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Niedersächsischen Landtag Stefan Schostok sagte zu den Vorgängen rund um den Sylt-Urlaub des Bundespräsidenten gestern zu BILD: „Offenbar finden gerade Versuche statt, Akten zu säubern.“ Der Fraktionschef der Grünen im niedersächsischen Landtag, Stefan Wenzel, forderte Ermittlungen der Behörden in diesem Fall. Wenzel zu BILD: „Wer solche Dokumente verschwinden lassen will, dürfte etwas auf dem Kerbholz haben. Hier muss endlich der Staatsanwalt ran!“
Die „Bild“-Geschichte war in allen entscheidenden Punkten falsch. Es gab keinen Vertuschungsversuch.
Groenewold hatte bemerkt, dass er keine Unterlagen hatte, um Fragen der Presse nach diesem gemeinsamen Urlaub beantworten zu können. Er rief beim Hotel an und bat, ihm Kopien der Rechnungsbelege zu schicken. Das Hotel lehnte das unter Verweis auf den Datenschutz ab — er müsse schon vorbeikommen. Groenewold bat um Diskretion, fuhr ein paar Tage später hin und holte Kopien ab.
Keine Anreiselisten, Meldescheine und Verzehrquittungen, wie „Bild“ schrieb. Nur Kopien der Rechnungsbelege. Zeugen bestätigten das der Staatsanwaltschaft.
Dass Groenewold keine Originaldokumente mitnahm, wusste „Bild“ schon am Tag vor der Veröffentlichung. Der Direktor des Hotels teilte der „Bild“-Chefredaktion am Nachmittag mit, es habe nie einen Versuch von Groenewold gegeben, etwas zu vertuschen oder zu vernichten. Er habe lediglich Kopien für seine Unterlagen erbeten.
Diese Information hätte der ganzen „Bild“-Geschichte die Brisanz genommen. Das Blatt ließ sie einfach weg.
Laut Wulff erklärte der Axel-Springer-Verlag das später damit, das Schreiben des Hoteldirektors sei nicht relevant gewesen, weil es in dem Artikel nicht darum gegangen sei, dass Herr Groenewold Originale angefordert habe. Das ist natürlich Unsinn, denn nur so konnte der Eindruck einer Vertuschung entstehen.
· · ·
Bis hierhin ist es bloß eine Geschichte, die niemanden überraschen kann, der sich ein bisschen mit den feinen Methoden der „Bild“-Zeitung beschäftigt. Es kommt aber noch besser.
Groenewalds Anwalt beeilte sich, gegen die falschen „Bild“-Behauptungen vorzugehen. Er erwirkte am 14. Februar 2012 beim Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung, die „Bild“ die Behauptung untersagte, auf Sylt sollten Beweismittel beseitigt werden. (Vier Monate später erkannte der Springer-Verlag sie in allen Punkten rechtskräftig an.) Eine Kopie des Gerichtsbeschlusses, der einen wesentlichen Teil der Berichterstattung der Vortage kassierte, schickte er an die Nachrichtenagentur dpa. Und die meldete:
Nichts.
Die Information war zwar angekommen. Man habe aber „aufgrund unseres Grundsatzes, immer auch die Gegenseite zu hören“, wie dpa gegenüber „Meedia“ erklärte, erst bei Springer nachgefragt. Springer hatte aber keine Eile mit der Antwort. Später sei die Sache dann, so dpa, „tatsächlich leider in unserem Nachrichtenfluss stecken geblieben“.
Natürlich hätte dpa keine Stellungnahme Springers abwarten müssen. Eine Bestätigung des Gerichtes hätte genügt. (Vorabmeldungen der „Bild“-Zeitung veröffentlicht dpa übrigens routinemäßig vorab ohne jede eigene Prüfung.)
Es gibt zwei Möglichkeiten, was bei dpa passiert ist. Entweder kam es da zu einer ganz unglücklichen Verkettung von Verzögerungen und Schlampereien. Oder die Nachrichtenagentur hatte einfach kein Interesse daran, diese für Springer unschöne Geschichte zu verbreiten. Springer ist einer der größten Kunden von dpa; dpa ist mit seinen Büros Untermieter bei Springer.
Drei Tage später trat Wulff zurück.
· · ·
So. Würde man nicht annehmen, dass diese Vorgänge rund um einen falschen und, wie ich sagen würde: absichtlich irreführend geschriebenen Bericht der „Bild“-Zeitung ein großes Thema in den anderen Medien wären? Noch einmal: Es handelt sich um den Artikel, der den Auslöser dazu bildete, dass Wulff zurücktrat. Ist das nicht eine große, berichtenswerte, recherchierenswürdige Sache? Ist es nicht bemerkenswert, dass Wulff am Ende durch eine Falschmeldung der „Bild“-Zeitung zu Fall gebracht wurde?
Offenbar nicht. Kaum jemand hat darüber berichtet. Die einzige größere Ausnahme, die ich gefunden habe, ist „Focus Online“. Dort berichtete die Berliner Korrespondentin Martina Fietz im November 2013, zwei Tage vor Beginn des Prozesses gegen Wulff, ausführlich über die Ungereimtheiten.
Die beiden Autoren der falschen „Bild“-Zeitungs-Geschichte, Martin Heidemanns und Nikolaus Harbusch, wurden im Mai 2012 von den führenden Journalisten des Landes mit dem Henri-Nannen-Preis in der Kategorie „Beste investigative Leistung“ geehrt. Ausgezeichnet wurde allerdings konkret ihr „Bild“-Stück über den Hauskredit Wulffs. Der damalige Chefredakteur des „Handelsblattes“ Gabor Steingart hatte vorher eine solche Würdigung für die beiden gefordert, denn: „Die ‚Bild‘-Geschichte war sauber recherchiert. Und sie war, da das Staatsoberhaupt schließlich zurücktrat, die wirkungsmächtigste Enthüllung des Jahres 2011.“
Dass die „Bild“-Geschichte derselben Autoren, wegen der Wulff tatsächlich zurücktrat, eine Falschmeldung war, interessierte Steingart so wenig wie die meisten Kollegen.
Christian Wulff schildert die Vorgänge ausführlich in seinem Buch „Ganz oben — Ganz unten“, das in der vergangenen Woche erschieden ist. Das wäre nochmal ein guter Anlass gewesen, sich diesem besonderen Kapitel der ganzen Affäre zu widmen, die eben auch eine Medienaffäre ist. Hat aber wieder keinen interessiert.
Stattdessen fragt zum Beispiel Hans-Martin Tillack, der „Stern“-Journalist, der bei Wulffs letzter Dienstreise nach Italien den Bundespräsidenten im Flugzeug anblaffte, ob er eigentlich im Ernst glaubte, dass sich irgendjemand dafür interessiere, was er in Italien vorhat, dieser sympathische Kollege also fragt auf stern.de stattdessen: „Wie schönfärberisch ist das Wulff-Buch?“
Das ist eine berechtigte Frage, und vermutlich ist auch mindestens ein Teil seiner für Wulff eher ungünstigen Antworten nicht falsch. Aber bemerkenswert dabei ist auch, wie beiläufig er dabei über die Sylt-Sache hinweggeht:
Den einzigen größeren Fall [sic!] einer Falschmeldung, den Wulff in seinem Buch erwähnt, betrifft einen Bericht der „Bild“-Zeitung vom 8.2.2012. Dort war in der Tat zu Unrecht der Eindruck erweckt worden, Wulffs Freund David Groenewold habe versucht, bei einem Hotel in Sylt Originale von Rechnungen verschwinden zu lassen.
Erwähnt, erledigt.
Anders als Wulff verstehe ich schon, warum so viele Journalisten offenbar glauben, dass es keine Rolle spielt, ob diese Geschichte falsch war. Für sie ist der Bundespräsident nicht wegen dieser einen Geschichte zurückgetreten, sondern wegen allem. Weil er eh fällig war, untragbar, peinlich, diskreditiert, da kommt es nicht auf so läppische Details wie den Auslöser des Rücktritts an. Natürlich ist an dieser Sicht etwas dran.
Diese eine, falsche Geschichte aber war der konkrete Auslöser des Rücktritts, und wer weiß, ob die Staatsanwaltschaft auch ohne sie die Aufhebung der Immunität beantragt hätte, und ob Wulff nicht dann im Amt geblieben wäre, beschädigt, aber, wie das so ist, mit der Chance, die Leute wieder für sich zu gewinnen. Jedenfalls muss man diese Episode kennen, um zu verstehen, warum Wulff meint, sein Rücktritt sei falsch gewesen. Ich kann seine Fassungslosigkeit verstehen, dass die Medien sich für diese Dinge so gar nicht interessieren. Dass die, die ihm jetzt wieder „Mehr Selbstkritik!“ zurufen, in größeren Teilen dazu selbst nicht in der Lage sind.
Dirk Kurbjuweit zum Beispiel. Kurbjuweit hat im „Spiegel“ vor Verachtung berstende Texte über Wulff geschrieben, hat ihm vorgehalten, sich mit Filmstars schmücken zu wollen, mit Filmstars! Voller Ekel malte er es sich aus, wie es gewesen sein muss, als Wulff 2007 in dem Hotel auf Sylt Groenewold das Geld in bar zurückzahlte: „Da stand also der Ministerpräsident von Niedersachsen und zählte einem 14 Jahre jüngeren Mann ein Bündel Geldscheine in die Hand. Wenn das nicht gelogen ist, wünschte man sich beinahe, es wäre gelogen, weil es so unwürdig ist.“ Man stelle sich das vor: einem 14 Jahre jüngeren Mann!

Im aktuellen „Spiegel“ übt Kurbjuweit ein klitzekleines bisschen Selbstkritik, aber vor allem kritisiert er Wulff. Er verteidigt vehement das „Grundrecht“ der Journalisten, Fragen zu stellen, als wäre das das Problem gewesen. Als hätten die Journalisten damals nicht fortwährend Antworten gegeben.
Auch Kurbjuweit ist die Sylt-Sache mit der „Bild“-Zeitung, die Wulff in seinem Buch beschreibt, nicht ganz entgangen. Ganze fünfeinhalb Druckzeilen widmet er ihr:
Selbstverständlich ist bei der Recherche nicht alles erlaubt. Wulff schreibt, dass Bild ein manipuliertes Schriftstück verwendet habe, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Das wäre dann auch ein Fall für den Staatsanwalt.
Ach guck mal, das wäre also ein Fall für den Staatsanwalt. Warum ist das nicht auch ein Fall für die Journalisten?
Wulff deutet in seinem Buch an, dass hinter der falschen Geschichte vom Vertuschungsversuch eine noch größere Manipulation durch „Bild“ stecken könnte; dass eine Notiz in den internen Hotel-Unterlagen, die als Indiz für den Vertuschungsversuch galt, fingiert sei. Es ist tatsächlich unbefriedigend, dass Wulff an dieser Stelle nur vage einen Verdacht andeutet. Aber vielleicht hätte es geholfen, wenn einer der vielen tollen investigativen Journalisten, die alle, wie Kurbjuweit in seinem Stück behauptet, keine gemeinsamen Kampagnen fahren und „nicht das Gemeinsame, sondern den Unterschied“ suchen und sich „abheben wollen von den Kollegen, exklusive Nachrichten zutage fördern“, dieser Sache damals nachgegangen wäre.
Aber es interessiert sie auch heute nicht.
Nachtrag, 11:30 Uhr. Hans-Martin Tillack vom „Stern“ bemängelt, dass ich nicht erwähnt habe, dass die Staatsanwaltschaft bei der Einleitung des Ermittlungsverfahrens von der einstweiligen Verfügung gegen „Bild“ wusste. In ihrem Antrag auf Aufhebung der Immunität sei das auch erwähnt und berücksichtigt.
In einem Blog-Eintrag kritisiert er ausführlich „die Methode Niggemeier“.



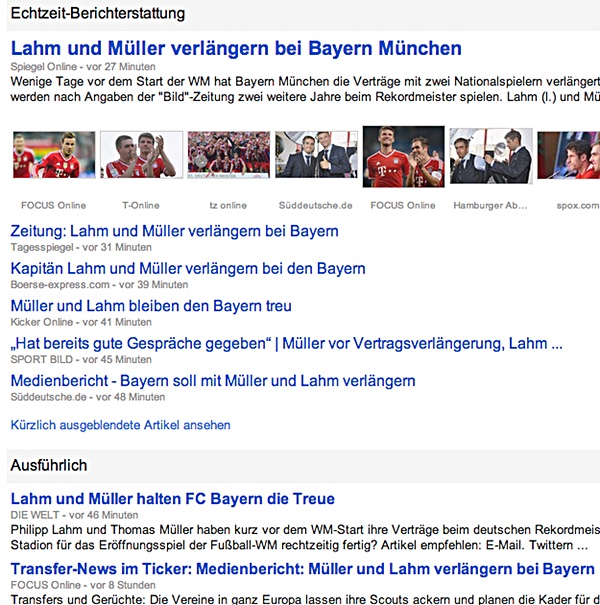




 Nichts gegen Werbung. Werbung ist theoretisch und oft auch praktisch eine wunderbare Art, hochwertige Inhalte zu finanzieren. Das Unternehmen gibt Geld und ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit.
Nichts gegen Werbung. Werbung ist theoretisch und oft auch praktisch eine wunderbare Art, hochwertige Inhalte zu finanzieren. Das Unternehmen gibt Geld und ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit.