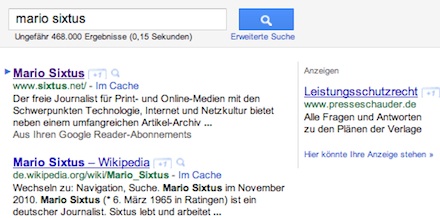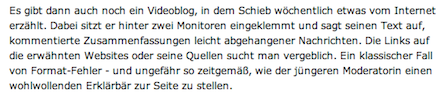Dreieinhalb Jahre lang haben Gaby Köster und ihr Management fast jeden Bericht über ihre schwere Erkrankung juristisch verhindert. Nun hat sie ein Buch über ihr Schicksal geschrieben und wirbt dafür, indem sie in einer Vielzahl von Medien und Talkshows all das erzählt, was sie vorher verbieten ließ. Wer dabei einen üblen Beigeschmack empfindet, soll sich von mir aus daran elend verschlucken.
Gestern hatte die Komikerin bei „Stern-TV“ ihren ersten Fernsehauftritt seit einem Schlaganfall im Januar 2008. Ihre linker Arm ist gelähmt, auch ihr linkes Bein hat sie immer noch nicht ganz unter Kontrolle. Gehen und Stehen fällt ihr schwer; ihr Gesicht wirkt um Jahrzehnte gealtert. Als ihre Begleiterin erzählt, dass sie Fortschritte mache, sagt Gaby Köster mit ihrem brutalen Gaby-Köster-Humor: „Ja, noch mehrere hundert Jahre, dann geht es vielleicht wieder.“ Sie raucht — „weil das was ist, was ich alleine machen kann“.
Sie soll in den nächsten Tagen noch beim „Kölner Treff“, bei „Volle Kanne“ und bei „Tietjen & Hirschausen“ auftreten sowie im November bei „Riverboat“. Sie hat mit der „Bild der Frau“ über ihre Erfahrungen gesprochen und mit dem „Stern“, der daraus eine Titelgeschichte gemacht hat.
Es gibt Leute, die ihr das nach der vorherigen Nachrichtensperre übel nehmen. Journalisten, vor allem. Man kann ein Beleidigtsein sogar zwischen den Zeilen einer dpa-Meldung erahnen, die erst Kösters PR-Termine aufzählt und dann anfügt:
Gegen die Berichterstattung über ihre Krankheit hatte sich Köster vor mehr als drei Jahren noch juristisch gewehrt. Jetzt tritt sie selbst damit in die Öffentlichkeit und vermarktet gleichzeitig ihr Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht – Meine zweite Chance“.
„Welt Online“ vermutet, dass Gaby Köster „nicht gut von einem Management beraten war, das eine völlige Informationssperre verhängte“. „Focus Online“ spricht von einer „Medien-Strategie, die zumindest fragwürdig ist“. Und in einem selbst für „Meedia“-Verhältnisse erbärmlichen Artikel stellt die Autorin Christine Lübbers „einen seltsamen Beigeschmack“ fest. Sie spekuliert, die Buch-PR „dürfte zumindest bei den Medien für Verwunderung und Diskussionen sorgen, die zuvor Unterlassungserklärungen im Zusammenhang mit der Krankheit Kösters abgegeben haben“.
Es scheint für diese beleidigten Journalisten unmöglich, die Wahrheit zu akzeptieren: Gaby Köster darf selbst entscheiden, wann und wie sie die Öffentlichkeit über eine Erkrankung informiert. Das ist ihr Recht, und zu diesem Recht gehört nicht nur die Möglichkeit, Berichterstattung zu unterbinden, sondern auch die Freiheit, sie wieder zuzulassen und sogar zu forcieren. Den Zeitpunkt, zu dem sie das tut, darf sie frei wählen und sich dabei ganz von der Frage leiten lassen, was für sie ideal ist — persönlich, gesundheitlich, geschäftlich.
Es ist, auch wenn sie eine Person der Öffentlichkeit war, wenigstens bei etwas so Intimem wie einer Krankheit: ihr Leben. Es gehört nicht „Bild“, nicht ihren Fans und schon gar nicht „Meedia“.
Natürlich ist es zulässig, jetzt öffentlich zu diskutieren, ob das Vorgehen von Gaby Köster oder ihrem Management und ihren Anwälten geschickt war — geschickt im Sinne von: günstig für Gaby Köster. Aber das Schmollen und Raunen der Medien, der implizite Vorwurf der Bigotterie, sind unangemessen und abstoßend.
Sie fühlen sich offenbar benutzt: Erst dürfen wir nichts schreiben und nun sollen wir ihr bei der PR helfen.
Nur gibt es gar keine Pflicht dazu, Teil von Gaby Kösters Vermarktungsstrategie zu werden. Niemand zwingt „Meedia“, für Kösters Auftritt bei „Stern-TV“ zu trommeln. Gaby Köster hat „Welt Online“ nicht dazu verpflichtet, in einer sechsteiligen Bildergalerie und über einem halben Dutzend Artikeln (inklusive Klickstrecke: „Die besten Überlebensmittel: US-amerikanische Forscher haben in getrockneten Apfelringen einen starken Cholesterinblocker gefunden“) über Kösters Rückkehr in die Öffentlichkeit zu berichten. So unvorstellbar das insbesondere für die meisten Online-Redaktionen zu sein scheint: Es gäbe die Möglichkeit, darüber nicht zu berichten.
Wenn die „Meedia“-Beigeschmackstesterin fragt:
„Wenn all das über lange Zeit als Privatsache geschützt wurde, warum soll nun plötzlich und quasi auf Knopfdruck alles wieder von öffentlichem Interesse sein?“
Lautet die Antwort: Weil sie, erstens, jetzt gerade gesund genug ist, das auszuhalten, und es, zweitens, ihre verdammte Entscheidung ist.
Der stellvertretende Chefredakteur von „Meedia“ fragt dann in den Kommentaren unter dem Beitrag noch:
gelten für Krankheiten andere Spielregeln der Berichterstattung? (…) Wann werden aus Personen öffentlichen Interesses wieder private Personen? Und wann werden sie wieder öffentlich? Wer legt das fest?
Er nennt das „offene Fragen“, dabei sind sie längst beantwortet — von Gerichten und vom Deutschen Presserat, der feststellt: „Körperliche und psychische Erkrankungen oder Schäden fallen grundsätzlich in die Geheimsphäre des Betroffenen.“ Das Wort „Geheimsphäre“ ist dabei kein Synonym für „Privatsphäre“, sondern ein noch stärker geschützter Bereich.
Aber selbst wenn die Journalisten von „Bild“, „Meedia“ & Co. das verstünden, würden sie es nicht akzeptieren.
Im „Focus Online“-Artikel sagt ein Medienethiker, der „Kommunikationsberuf“, den Köster als „TV-Unterhalterin“ ausübe, bringe „doch gewisse Pflichten mit sich“. In vielen Varianten heißt es dort, das Management hätte doch wenigstens kurz sagen können, dass Gaby Köster krank ist, aber lebt. Schon Anfang 2009 schrieb „Focus Online“, die Fans wollten doch „nur etwas mehr Gewissheit. Wird die Kabarettistin jemals wieder auf einer Bühne stehen?“ Diese „Gewissheit“ hätte sicher auch Gaby Köster gerne gehabt. Vor allem aber: Was für eine rührende Naivität, zu denken, die Medienbranche funktioniere so, dass man den Leuten von „Bild“ oder RTL einen kleinen Informationsbrocken hinwirft und die sich dann damit zufrieden geben und nicht weiter versuchen, Schnappschüsse von Frau Köster im Rollstuhl zu erhaschen.
Die ganze Infamie von „Meedia“ in einem Satz:
Und mancher wird sich fragen, ob die juristische Unterdrückung der Berichterstattung nicht vor allem dazu gedient haben könnte, die Ware Information in dieser Sache über einen langen Zeitraum künstlich zu verknappen, damit anschließend der Aufmerksamkeits- wie Vermarktungswert der Story umso größer ist.
Auf welchen Zeitraum mag sich Frau Lübbers beziehen? Meint sie, die Berichterstattung wurde unterdrückt, als Gaby Köster noch im Krankenhaus zwischen Leben und Tod war, um bestens gerüstet zu sein für den Fall, dass sie ein Buch schreiben will, für den Fall, dass sie überlebt? Oder während der Zeit, als sie daran arbeitete, in ein Leben zurückzufinden, in dem sie die überhaupt in der Lage sein würde, ein Buch zu schreiben?
Und selbst wenn es so wäre, dass die ganze Informationswarenverknappung nur dazu gedient hätte, den Vermarktungswert zu steigern — wäre das nicht legitim? Gaby Köster hat sich den Schlaganfall ja nicht ausgesucht, um ihrer Karriere eine originelle Wendung zu geben. Sie habe, sagt sie im „Stern“, in den vergangenen dreieinhalb Jahren, ihre „Rente verblasen“. Es ist völlig unklar, ob sie je wieder in ihrem Beruf als Komikerin oder Schauspielerin arbeiten kann. Kann man ihr es dann nicht gönnen, wenigstens das meiste aus diesem Buch herauszuholen?