Aus der Reihe „Argumente gegen das iPad“, Folge 2791: die eingebaute Kamera.
(Andererseits natürlich: aaaaaaalt.)
Aus der Reihe „Argumente gegen das iPad“, Folge 2791: die eingebaute Kamera.
(Andererseits natürlich: aaaaaaalt.)
Man kann vieles gegen Helena Fürst sagen. Aber sie schafft es, dass man sie schon nach zwei Minuten schlagen möchte. Das muss man auch erstmal schaffen.
RTL hat Helena Fürst von der Straße geholt. Sie war selbstverschuldet in Not geraten, hatte sich beruflich in eine Sackgasse manövriert. Sie hatte als Sozialfahnderin für den Kreis Offenbach gearbeitet und eine kurze, steile Medienkarriere gemacht, indem sie das Fernsehen mitnahm in die Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern, die alle unter Schmarotzerverdacht standen. Sie überprüfte für die Sat.1-Sendung „Gnadenlos gerecht“, ob das Elend wirklich schon groß genug war, dass der Staat helfen müsste. Helena Fürst inszenierte sich als Richterin mit dem Mitgefühl eines Hochdruckreinigers.
Anderen gefiel sie in dieser Rolle offenbar nicht so gut wie sie sich selbst. Sie sagt, sie sei von Betroffenen bedroht und von Kollegen gemobbt worden. Sie ließ sich krankschreiben und flüchtete nach Berlin. RTL schenkte ihr eine neue Identität: Als „Anwältin der Armen“ half sie nun Menschen im Kampf gegen Behördenwillkür; seit vergangener Woche regelmäßig in der Primetime (mittwochs, 21.15 Uhr).
Die Firma „Solis TV“, die auch schon „Gnadenlos gerecht“ produziert hatte, sagt, Fürst habe die Seiten gewechselt. Das stimmt natürlich nicht. Ihr Job ist der alte: Menschen in Not vor der Kamera bloßstellen. Die Mutter von drei kleinen Kindern, einem davon schwerkrank, denen die Behörden alle Leistungen gestrichen haben, fragt sie beim ersten Treffen: „Machen Sie sich Vorwürfe, dass Ihre Tochter nicht zum Arzt kann? Denken Sie, Sie sind daran Schuld?“ Sie bringt die Frau gezielt zum Weinen, um sich dann als Trösterin zu geben: „Nicht weinen!“
Geifernd sagt sie über den überforderten Vater in die Kamera: „Ich werde ihn richtig hart rannehmen.“ Sie schüchtert ihn ein, dass er nur noch sagt, was sie hören will, um ihm dann zu drohen, sie werde sofort gehen, wenn er nicht aufhöre, ihr nach dem Mund zu reden. Die Hartz-IV-Domina passt gut zu RTL. Sie ein fast so großer Menschenfreund wie Dieter Bohlen.
Der Preis für die Unterstützung durch das Fernsehen ist bei allen „Coaching“-Shows die Ausstellung in der Öffentlichkeit. Das muss, je nach Verantwortungsbewusstsein der Produzenten und Helfer, kein schlechter Deal sein für die Betroffenen. „Helena Fürst“ aber ist ganz auf die maximale Demütigung der Opfer ausgerichtet. An Inhalten oder Schicksalen ist die Show nicht interessiert, wenn sie nicht der Heroisierung von Frau Fürst dienen, die wie ein Panzer durch die Leben der Leute walzt, die es mit ihr zu tun kriegen. „Was glauben Sie, was ich erreicht habe“, lässt sie die „Armen“ mehrmals raten, um möglichst wirkungsvoll mit ihren Erfolgen zu prahlen.
So viele Arbeitslose in diesem Land, aber Helena Fürst hat einen Job. Die Welt ist nicht gerecht.
Die amerikanische Komikerin Roseanne hatte kürzlich einen schlimmen Brech-Durchfall, der in der Zeitschrift „New York“ gelandet ist. Sie rechnet darin mit vielen Leuten ab, die ihr bei der Arbeit in die Quere gekommen sind. Am Anfang könnte man kurz denken, es sei ein nachdenkliches, selbstkritisches Stück darüber, was Erfolg aus Menschen wie ihr und Charlie Sheen machen kann. Aber dann prahlt sie damit, die erste und letzte feministische Arbeiter-Sitcom im Fernsehen geschrieben zu haben, und begleicht Jahrzehnte alte offene Rechnungen.
Das ist erhellend und traurig, wenn man — wie ich — großen Respekt vor der ihrer tatsächlich revolutionären Serie „Roseanne“ hat. Aber es ist ein guter Anlass, das Blog von Ken Levine vorzustellen.
Ken Levine ist ein 61-jähriger amerikanischer Fernsehautor, der unter anderem für „Cheers“, „Frasier“, und „Die Simpsons“ gearbeitet hat. In seinem Blog plaudert er aus dem Nähkästchen, beantwortet Leserfragen, gibt Berufstipps für Möchtegern-Comedy-Autoren und diskutiert, warum etwas lustig ist.
Und er nahm Roseannes Stilisierung zum Opfer auseinander und erzählte, wie sie mit den Mitarbeitern umgegangen sei, als sie endlich das Sagen hatte. Ein Autor schaltete, nachdem er gekündigt hat, eine Anzeige in der Fachpresse und schrieb:
„My wife and I have decided to share a vacation in the peace and quiet of Beirut.“
Als es danach ein endloses Kommen und Gehen gab und Roseanne keine Lust hatte, die Namen der wechselnden Leute zu lernen, habe sie sie bei Durchlaufproben Zahlen um den Hals tragen lassen. Levines bitteres Fazit:
She takes comfort in being such a champion for integrity, dignity, and women’s rights. Sure wish I had a picture of her women writers during runthrough wearing numbers around their necks.
Gestern bloggte Levine dann über „Two And A Half Men“, lachte darüber, dass Hugh Grant angeblich die Rolle von Charlie Sheen abgelehnt habe, weil so eine wöchentliche Serie womöglich zuviel Arbeit sei, und erklärte, warum das sehr abwegig ist.
Eigentlich lohnt sich der Blogeintrag schon für seine Kurzzusammenfassung von „Two And A Half Men“:
(…) to me it’s just a half-hour barrage of penis jokes with the occasional masturbation joke thrown in to break things up.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Journalisten-Seminars „Lernen von den Profis“. Als Gastreferenten für das heutige Modul „Lockendrehen auf Glatze XXVI“ konnten wir die „Spiegel“-Redakteure Ullrich Fichtner und Dirk Kurbjuweit gewinnen.
Stellen wir uns vor: Katastrophe in einem großen Nachrichtenmagazin. Kurz vor Redaktionsschluss ist die Titelgeschichte weggebrochen. Es bleibt nur eine halbe Stunde, um aus dem Nichts zehneinhalb Seiten zu füllen. Als Ersatztitelthema erwürfelt wird: der Absturz des Dominique Strauss-Kahn.
Und los! Die Zeit läuft.
1. Beginnen Sie mit Fakten. Irgendwelchen wahllosen Fakten. Das macht den Eindruck akribischer Recherche.
Rikers Island liegt im East River direkt in den Flugschneisen des New Yorker Airports La Guardia, die Tage auf der Gefängnisinsel beginnen und enden im Lärm sehr nahen Flugverkehrs, um 5 Uhr gehen die Lichter an in den Zellen und Baracken von 14 000 Häftlingen (…).
2. Verlieren Sie sich in Details. Die Menschen werden beeindruckt sein und staunen, woher Sie das alles wissen, selbst wenn die Antwort darauf ebenso banal ist wie der Inhalt.
Strauss-Kahns Frühstück bestand aus einer Minibox Cornflakes, Milch, zwei Scheiben Toast, Obst, Kaffee oder Tee. Mittags gab es auf Rikers Island Gemüsechili mit Reis und Bohnen, zum Abendessen um 17 Uhr wurden Truthahnburger mit Kartoffelstampf gebracht. Um 23 Uhr ging in der Anlage, wie an allen Tagen, das Licht aus, aber nicht in Strauss-Kahns 3,40 mal 4 Meter großer Einzelzelle (…).
3. Ergooglen Sie ein paar Details, die den Eindruck erwecken, Sie kennten die Gegend wie Ihre Westentasche.
Immerhin entstieg dieser Häftling der First Class eines Air-France-Flugzeugs, einer Luxussuite des Sofitel Manhattan an der 44. Straße, wo im Nachbarhaus der verrückte Koch des „db Bistro Moderne“ schwarze Trüffeln über Hamburger hobelt, die mit Entenstopfleber gefüllt sind.
4. Machen Sie deutlich, dass dies hier nicht irgendein Titelthema ist, ein Ersatz-Titelthema gar, sondern die größte Geschichte, die je aufgeschrieben wurde. Lassen Sie die Apokalypse im Vergleich wie einen lächerlichen Kurzschluss wirken.
Die Bilder von [Dominique Strauss-Kahn] in Handschellen und die anderen, die ihn unrasiert, hilflos vor der Haftrichterin zeigten, löschten ihn aus als Figur der Macht, sie disqualizierten [sic] ihn für jedes denkbare Amt, es waren Bilder, die Frankreich ins Herz trafen und Schockwellen in die ganze Welt sandten.
5. Blasen Sie einzelne Sätze auf wie ihre ganze Geschichte. Leihen Sie sich zur Not von einer Kollegin oder Matussek einen Fön.
Kein Thema der vergangenen Woche – nicht die Kernschmelze von Fukushima, nicht die Toten in Syrien, nicht Obamas neue Nahost-Rede, noch nicht einmal der Beginn der Schlussplädoyers im Kachelmann-Prozess, bei dem es auch um den Vorwurf der Vergewaltigung geht und die möglichen Irrwege eines Prominenten, um einen weiteren Mann, der den Versuchungen eines Doppellebens nicht widerstehen konnte – hätte größere Wucht entfalten können.
6. Zählen Sie: „Eins, zwei, auffällig zahlreich“.
Er dreht sich um die Rätsel der menschlichen Psyche, darum, was Ruhm und Einfluss mit den Ruhm- und Einflussreichen machen, die sich gerade auffällig zahlreich in bestürzenden Verfahren wiederfinden. Im März wurde Israels ehemaliger Staatspräsident Mosche Katsav wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und sexueller Nötigung von Untergebenen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt (…).
In Italien steht Premierminister Silvio Berlusconi Ende Mai in Mailand vor Gericht, um sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, er habe Sex mit einer Minderjährigen gehabt.
7. Keine Angst vor abgegriffenen, schnell wechselnden und schiefen Metaphern!
Das Karussell der zugehörigen Fragen, Satzfetzen und Vermutungen kreist in irrem Tempo, seit Strauss-Kahn vor zehn Tagen im Terminal 1 des John-F.-Kennedy-Flughafens abgeführt wurde, aus dem Flugzeug heraus festgenommen, in dem schon die Vorbereitungen für den Abflug im Gange waren. Der Zirkus der Gerüchte, der Zitate und wilden Theorien füllt jetzt die globale Manege (…)
8. Schauen Sie, ob auf Twitter nicht irgendjemand irgendwas zum Thema gesagt hat.
(…) vielleicht hat „PrincessiAm_920“ in der Nacht zum Mittwoch den harten Kern der Affäre bislang am griffigsten zusammengetwittert: „Money. Sex. Power. Respect.“ ((„PrincessiAm_920“, die auch in dieser Woche auf Twitter wieder Furore macht mit ihrer bestürzend-markanten Formulierung: „I want pizza“.))
9. Finden Sie irgendeine vage Parallele zu früher, besser: ganz früher.
Strauss-Kahns Absturz aus den Höhen der Weltpolitik in eine Einzelzelle ist das harte Material, aus dem auch schon die griechischen Tragödien gemacht waren.
10. Machen Sie sich nichts draus, wenn Sie auf die Schnelle keine passenden wissenschaftlichen Erkenntnisse finden. Zitieren Sie einfach irgendwas aus irgendeinem Film, den Sie kennen.
Es geht um Sex, um Sex und Macht, um die Quellen herrischer Männlichkeit, um die geheimnisvollen Muster von Attraktivität, die, trotz aller Forschung, immer im Ungefähren und Dunkeln liegen werden. Wer eine Krücke sucht, wird am ehesten noch in der Kunst fündig, die ein paar gute Formeln zur Aufhellung bereithält. Im Film „Scarface“ sagt Al Pacino als Tony Montana: „In diesem Land“, gemeint ist natürlich Amerika, „musst du zuerst Geld machen. Wenn du das Geld dann hast, bekommst du die Macht. Und wenn du die Macht hast, kriegst du die Frauen.“ Ist das die Formel? Die Lösung des Rätsels Strauss-Kahn?
11. Formulieren Sie auch Gedanken, die spontan einleuchten, mit erschöpfender Redundanz.
Es ist eine Welt, in der man leichter dem Wahn verfallen kann, im eigenen Spiegelbild einen Übermenschen zu erkennen. Spitzenpolitiker vom Schlage Strauss-Kahns leben unter ähnlichen Bedingungen wie Musikstars oder Schauspieler. Sie sind Beobachtete, und alles, was sie sagen oder tun, wird von den Medien gierig aufgesaugt und ausgestellt. So werden sie zu Darstellern ihres eigenen Lebens, Kameras sind immer dabei, die alles aufzeichnen, jede Regung festhalten,so als hätte alles eine besondere Bedeutung. Immerfort wird das Ego genährt. Limousinen fahren vor, Leibwächter springen herbei, Gassen werden geschlagen: Wo der Mächtige ist, ist der Mittelpunkt.
12. Wo es ein Wort tut, tun es auch vier. Oder acht.
Diese sind die direkten, sofort erreichbaren Untertanen, die Referenten, Pressesprecher, Sekretärinnen, Praktikantinnen. Sie müssen folgen, müssen zur Verfügung stehen, loyal sein, gehorsam, immer auf Empfang.
13. Kommen Sie von Höcksken auf Stöcksken. Eine Vergewaltigung hat zwar mit einem Seitensprung nichts zu tun, aber beides hängt irgendwie mit Sex zusammen, und wenn es Mächtige tun, auch mit Macht, und wenn man „Sex und Macht“ aufs Cover schreibt, lassen sich leicht wieder mehrere Absätze füllen.
Dass Macht und Libido ungut Hand in Hand gehen können, ist jedenfalls keine französische Erfindung, sondern ein universelles Phänomen. Vergangene Woche, als Strauss-Kahn gerade in Rikers Island eingefahren war, sah sich Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger dazu gezwungen, ein mit einer Hausangestellten – außerehelich, versteht sich – gezeugtes Kind bekannt zu machen.
14. Stören Sie sich – wenn es der Länge dient – nicht an lästigen logischen Widersprüchen wie dem, dass Sie gerade noch die einzigartige Größe des Themas Strauss-Kahn beschrieben haben.
Die Nachricht über den „Sperminator“ schlug in den USA so laut ein wie die Affäre um diesen alten Europäer mit dem komplizierten Namen (…).
15. Neues Thema, neue Gelegenheit, mit irgendwelchen Fakten zu beeindrucken. Machen Sie sich von dem Gedanken frei, dass sie zu irgendwas führen müssen.
(…) Schwarzenegger ließ es sich schon seit Januar, seit er aus dem Amt ausgeschieden war, auf diversen Ausflügen gutgehen. Regisseur James Cameron begleitete er auf Flusstouren nach Brasilien, er vergnügte sich beim Skifahren in Val d’Isère. Ganz das alte Alphatier.
16. Gehen Sie beim freien Themen-Assoziieren vom nun erreichten Punkt in der Geschichte aus, nicht vom Ausgangspunkt, und erfreuen sich der erzählerischen Möglichkeiten.
Das „oral office“ des Präsidenten Bill Clinton ist Legende wie die Affären des weitverzweigten Kennedy-Clans mit dem allzeit bereiten John F. vorneweg. Dieser Tage zieht der katholische Republikaner Newt Gingrich als bibelfester Konservativer über die Dörfer, um sich als möglicher Präsidentschaftsbewerber vorzustellen, und niemand scheint sich daran zu stören, dass auch er schon in dritter Ehe verheiratet ist und seine aktuelle Gattin nur deshalb erobern konnte, weil sie für ihn fortlaufend das heilige Sakrament der Ehe brach.
17. Wenn Ihnen die Lust ausgeht, die Welt oder die Geschichte nach weiteren irgendwie passenden Fällen abzuklappern, schreiben Sie zumindest auf, dass Sie es könnten.
So ließe sich die Welt abklappern nach lokalen und regionalen Gepflogenheiten im Umgang mit Sex und Macht, und wer die Geschichte studiert, kann sich für den Rest seines Lebens Gedanken machen über die moralische Integrität früherer amerikanischer Präsidenten und deutscher Bundeskanzler, über die Gastfreundschaft chinesischer Firmen, die ihren Geschäftspartnern gern Mädchen aufs Hotelzimmer schicken, über die Affären englischer Premierminister und nicaraguanischer Präsidenten und natürlich über die Bunga-Bunga-Partys des Superbuffo Silvio Berlusconi und seiner Gäste aus Tschechien und sonst woher.
18. Geben Sie den Lesern das Gefühl, sich trotz der überwältigenden Textmenge auf das Wesentliche beschränkt zu haben, indem sie erwähnen, welche Assoziationsketten Sie (aus Zeitmangel) nicht bis zum Ende verfolgen konnten:
Macht ist in der menschlichen Gesellschaft ein ganz relatives Ding. In fast jeder Beziehung, und selbst wenn sie nur zwei Menschen betrifft, bilden sich Hierarchien, und der eine hat folglich Macht über den anderen.
19. Vermeiden Sie den Eindruck, geschwafelt zu haben, indem Sie kurz vor Schluss noch ein paar Informationsstreusel über ihren Text bröseln:
Das Paar Strauss-Kahn-Sinclair verfügt über eine Sechszimmerwohnung im 16. Arrondissement von Paris und unterhält ein 240-Quadratmeter-Appartement an der Place des Vosges. Es gibt eine 380-Quadratmeter-Villa in Washington und eine Residenz in Marrakesch, deren Küche allein 160 000 Euro gekostet haben soll.
20. Versuchen Sie sich als Psychologe und Exeget, auch wenn Sie nur ein Gefühlshaber sind.
Der letzte Halbsatz seiner Rücktrittserklärung an den IWF lautet, „ich möchte nun vor allem – vor allem – all meine Kraft, all meine Zeit, alle meine Energie dem Ziel widmen, meine Unschuld zu beweisen“. Es ist nur ein Gefühl, aber beim Lesen der Erklärung, die nicht sehr lang ist, stellt sich der Eindruck ein, dass sie nicht so klingt wie die eines Mannes, der zu Unrecht einer ungeheuerlichen Straftat angeklagt ist und seine Ehre wiederherstellen will.
Geschafft: 37.500 Anschläge (hier steht natürlich nur ein Bruchteil davon). Ein „Spiegel“-Not-Aufmacher in dreißig Minuten. Es gibt Leute, die können nicht einmal so schnell tippen.
(Sicherheits-Hinweis: Ich weiß nichts darüber, unter welchen Bedingungen der hier behandelte Artikel „Des Menschen Wolf“ aus dem aktuellen „Spiegel“ wirklich entstanden ist. Womöglich ist er die stark gekürzte Version eines doppelt so langen Essays, an dem die Autoren viele Tage und Nächte gearbeitet haben. Ich möchte mir das nicht vorstellen.)
Der Braanchendienst „Meedia“ hat mit Chefredakteur Frank Thomsen über meine Kritik an stern.de gesprochen. Thomsens Kernaussage ist möglicherweise:
Eine News-Seite ist ein komplexes Gebilde aus verschiedensten Dingen, die auch gewürdigt werden von Usern.
Die Tatsache, dass stern.de systematisch Bildergalerien, Videos, aber auch Artikel vervielfältigt und umdatiert und so zum Beispiel auch eine vier Jahre alte Falsch-Meldung als aktuell ausgibt, hält Thomsen für „sehr tiefgehende Technik-Diskussionen und viel Klein-Klein“. Das Veröffentlichungsdatum eines Artikels für das Veröffentlichungsdatum eines Artikels zu halten, nennt er ein „Missverständnis“.
„Ein Stadtplan auf dem Rücken“ betitelt stern.de den Bericht, dass sich Xavier Naidoo keinen Stadtplan auf seinen Rücken tätowieren lassen will, aber das ist nicht das Merkwürdigste daran. Über dem Artikel steht das Datum „17. Mai 2011“, aber im Text heißt es:
Wenn [Naidoo] am 7. Dezember mit seiner neuen Single „Was wir alleine nicht schaffen“ bei der Verleihung der Auszeichnung Eins Live Krone 2006 auftritt, könnte er bereits die ersten Umrisse der Tätowierung präsentieren.
Der Artikel ist viereinhalb Jahre alt. Am 14. November 2006 hatte ihn stern.de erstmals veröffentlicht. Passend zu einem aktuellen Videointerview mit Xavier Naidoo holte man ihn aus dem Archiv, gab ihm eine neue Internetadresse und das aktuelle Datum.
Das hat Methode.
Ein Reuters-Video über die Verurteilung des Hauptangeklagten in einem großen Missbrauchs-Prozess hat stern.de schon mindestens dreimal veröffentlicht – jeweils verknüpft mit einem aktuellen Artikel und versehen mit einem neuen Datum (was in diesem Fall besonders verwirrend ist, weil im Vorspann die Rede davon ist, dass das Gericht „am Dienstag“ entschieden habe, was jemanden, der sich auf stern.de darüber informieren wollte, wann das tatsächlich war, vor größere Probleme stellen würde):
Wenn auf stern.de bei einem Video mit heutigem Datum steht, dass die Nato „in der vergangenen Nacht“ Luftangriffe auf Tripolis geflogen hat, muss das nicht heißen, dass die Nato in der vergangenen Nacht Luftangriffe auf Tripolis geflogen hat. Es kann auch sein, dass ein (mindestens) zwei Tage altes Video einfach umdatiert und unter neuer Adresse noch einmal veröffentlicht wurde. Wie hier:
stern.de setzt konsequent darauf, Text-Beiträge, Videos, Foto-Galerien und Extras zu einem Thema miteinander zu verknüpfen. Das ist theoretisch sinnvoll und praktisch. In der Form, wie stern.de es tut, ist es grotesk.
Irgendwann gestern muss stern.de eine Fotogalerie zum Kachelmann-Prozess veröffentlicht haben. Sie trägt den Namen „Staatsanwalt zitiert vertrauliche SMS“ und beginnt mit Fotos vom gestrigen Prozesstag. Später folgen auch Aufnahmen und Notizen von früheren Prozesstagen. Insgesamt sind es aktuell 58 Fotos.
Offenbar wird diese Galerie seit dem ersten Prozesstag immer wieder ergänzt. Vor allem aber: Sie wird jedesmal, wenn stern.de einen neuen Artikel veröffentlicht, zu dem sie inhaltlich passt, neu veröffentlicht, mit einer eigenen Internet-Adresse und dem jeweiligen Datum. Ich vermute, die folgende Auflistung ist nicht komplett:
Es ergibt sich auch der verblüffende Effekt, dass stern.de scheinbar schon im März Fotos veröffentlicht hat, die erst im Mai entstanden. (Mögliche Schäden im Raum-Zeit-Kontinuum gleichen aber die Videos aus, die sich — wie oben beschrieben — auf einen Vortag beziehen, der bereits Wochen zurück liegt.)
Immerhin kann ich jetzt die Behauptung des Gruner+Jahr-Vermarkters halbwegs nachvollziehen, stern.de sei das „bildstärkste publizistische Angebot im deutschsprachigen Internet“ und veröffentliche „täglich rund 600 neue Fotos“. Die zählen einfach bei jeder Wiederveröffentlichung neu.
So simuliert der „Stern“ also ein richtiges Internet-Angebot, ohne das Geld für ein richtiges Internet-Angebot ausgeben zu müssen. Er konzentriert seine Energien auf das Importieren und Umschreiben günstiger Agenturtexte. Und er recyclet seine Inhalte so, dass sie — für den flüchtigen Leser, aber sicher auch für Suchmaschinen — immer wieder neu erscheinen.
Ich habe mich ja vergangene Woche neu in Anke Engelke verliebt. Und auf YouTube ist vor ein paar Tagen ein Video aufgetaucht, das einen Grund dafür zeigt.
Es sind Aufnahmen vom Ende der Generalprobe fürs Finale des Eurovision Song Contest. In der (zufälligen) Punktevergabe hatte der sandige Beitrag aus der Ukraine gewonnen. In der Probe übernahm Frau Engelke nun kurzerhand den Part, den Siegertitel noch einmal vorzutragen:
[Nachtrag, 23. Mai: Der NDR hat das Video anscheinend löschen lassen.]
Übrigens hatte die ARD dann glücklicherweise doch nicht die komplette Berichterstattung über den Grand-Prix an das Vertretungspersonal am Brainpool-Fließband ausgelagert. Versteckt am späten Sonntagabend im NDR-Fernsehen lief eine angenehm klassische Reportage.
Anders als die Leute, die für das schlimme Vorabgetöse verantwortlich waren und offenbar verzweifelt versucht hatten, irgendetwas aus dem Grand Prix zu machen, hatten die Filmemacher Andreas Ammer und Anke Hunold gemerkt, dass die Veranstaltung ein solches Übermaß an Stoff hergibt, dass es genügt, dabei zu sein, zuzusehen, mitzugehen, nachzufragen. Hier gibt es (für Duslog-Gucker) ein Wiedersehen mit Florian Wieder, der Estin, dem Finnen und natürlich Lena. Die Episode mit dem estnischen Silhouettenkrempel auf der Bühne wird in schöner Ausführlichkeit erzählt (und weitere wunderbar alberne Momente mit Anke gibt es auch):
Claus Strunz räumt seinen Posten als Chefredakteur des „Hamburger Abendblattes“ und verantwortet von Juli an die Bewegtbild-Inhalte der Axel Springer AG, was insofern konsequent ist, als Videos ja journalistisch bestimmt in den Kreis der Top vier neben „FAZ“, „Süddeutsche Zeitung“ und „Welt“ gehören. Außerdem geht Herr Strunz gerne dann, wenn es am Schönsten ist, und schöner wäre es beim „Abendblatt“ unter ihm vermutlich nicht mehr geworden.
Der Braanchendienst „Meedia“ schwurbelt:
Ein Blick auf die Auflagenentwicklung von Abendblatt zeigt, dass der Käufermarkt für das renditestarke Regional-Flaggschiff von Springer unter Druck steht (…).
Das soll wohl heißen: Immer weniger Menschen kaufen das „Hamburger Abendblatt“. Und seit Claus Strunz dort vor zweieinhalb Jahren Chefredakteur wurde, ist alles noch schlimmer geworden.
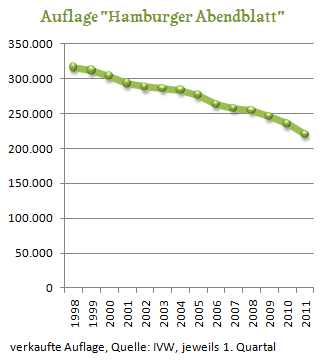
Der Einzelverkauf ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um erstaunliche 13,5 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Abonnenten sank im gleichen Zeitraum um fast fünf Prozent — so schnell wie die zehn Jahre zuvor nicht.
Dabei hatte Strunz ein Jahr nach seinem Antritt behauptet, die Print-Auflage „weitestgehend stabilisiert“ zu haben (was auch damals schon halb gelogen war); Springer hatte von einer Trendwende gesprochen. Dass sich kein Aufschwung einstellen wollte, kann jedenfalls nicht an mangelnder heißer Luft gelegen haben. Strunz erfand sogar den Begriff „Abendblatt 3.0“. Der sollte stehen für: das Jahr 3000, einen mehr als „2.0“ sowie die drei Säulen Lokales, Regionales und Bundesweites.
Nun darf Strunz nicht einmal drei Jahre voll machen.
Aber man muss den Springer-Verlag als Arbeitgeber für die Treue zu seinem Leitungspersonal bewundern: Bislang fand sich für jeden immer noch ein Titel und ein Schreibtisch, wo er — unbelastet von den Unheilanrichtungsmöglichkeiten des Tagesbetriebs — vor sich hinwerkeln konnte. Für Strunz wurde der Bereich „TV- und Videoproduktionen“ neu geschaffen. Strunz berichtet sicherheitshalber direkt an den Vorstandsvorsitzenden.
Vermutlich castet er in diesem Moment schon vor dem Badezimmerspiegel Moderatoren für neue Videoformate.
Auf den ersten Blick ist es leicht, stern.de mit dem hochwertigen journalistischen Angebot zu verwechseln, als das es sich ausgibt. Auf der Startseite verbinden Fotos aktuelle Themen zu großen Blöcken; im Inneren sprudeln rund um die Uhr die Nachrichten.
Der Verlag Gruner+Jahr nennt stern.de „eine Art ‚Antwortmaschine‘ von Menschen für Menschen. Alle Nachrichten werden auf ihre Bedeutung für den User fokussiert und mit weiterführenden multimedialen Inhalten verlinkt“. Der Werbevermarkter ems schreibt, stern.de richte sich „an alle, die aktuelle Themen nicht nur wissen, sondern deren Bedeutung für ihr Leben verstehen wollen“. Chefredakteur Frank Thomsen zählt seine Seite zur „Spitzengruppe“ der „News-Websites“.
Nun.
367 Artikel hat stern.de gestern veröffentlicht. Knapp 300 davon sind Agenturmeldungen, die vollautomatisch in den „Nachrichtenticker“ von stern.de einfließen. Es verbleiben 76 Artikel (Übersicht).
Davon sind:
Es verbleiben:
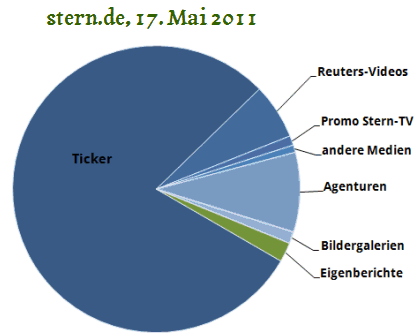
Die mehr oder weniger eigenen Berichte sind:
(Christoph Fröhlich)
Davon müsste man jetzt, streng genommen, noch den Artikel über die neuen Gepäckregeln bei der Lufthansa abziehen, der vor allem aus der — teils wörtlichen — Übernahme einer Lufthansa-Pressemitteilung besteht.
Die eigene journalistische Leistung von stern.de bestand gestern also im Wesentlichen aus einem Videointerview mit den Söhnen Mannheims, einem Stück über die Bundeswehrreform und einem Artikel über Kritik an Vogelruf-Apps.
Nun steckt natürlich auch in den Agenturmeldungen, die stern.de nicht bloß in den Nachrichtenticker fließen lässt, Arbeit. Die Redaktion redigiert oder kürzt sie, baut Links zu eigenen Seiten und Quellen ein und denkt sich gelegentlich originelle Überschriften aus. Die Meldung, dass sich Xavier Naidoo keinen Stadtplan auf seinen Rücken tätowieren lassen will, betitelt sie: „Xavier Naidoo: Ein Stadtplan auf dem Rücken“.
Das war an einem zufälligen Tag (gestern) das Internetangebot des „Stern“: Knapp sieben eigene Artikel und fünf Bildergalerien, angereichert mit Hunderten von Agenturen eingekauften Meldungen, die exakt oder annähernd wortgleich überall sonst stehen.
Das Online-Angebot des „Stern“ hat sich in den vergangenen Jahren von einem großen Teil seiner Mitarbeiter und ungefähr jedem inhaltlichen Anspruch verabschiedet. Als nicht mehr genug Leute da waren, um damit die acht Textressorts zu füllen, löste man die Ressorts auf. Unter den Namen „Projekt Blau“ wurde das zur strategischen Entscheidung verbrämt. Seitdem gibt es nur noch die Ressorts Nachrichten und Wissen — sowie anscheinend eine Stabsstelle, die sich überraschend Formulierungen über die Arbeitsweise der Redaktion ausdenkt, die weitestmöglich von der Realität entfernt sind. So sagte Frank Thomsen im vergangenen Jahr im Braanchendienst „Meedia“:
Wir wollen künftig mutiger auswählen, entschiedener im Umgang mit den News sein. Wir werden uns redaktionell auf die Topthemen konzentrieren und dazu mehr und vertiefende Inhalte anbieten. (…) Der Grundgedanke lautet: mehr in die Tiefe als in die Breite denken und lieber am Rand etwas weglassen. Austauschbare Nachrichten gibt es genug. (…) Wir setzen auf die großen Themen, hier wollen wir Fachkompetenzen bündeln.
Das wäre eigentlich ein treffender Werbeslogan für stern.de: „Austauschbare Nachrichten gibt es genug, und bei uns stehen sie alle!“
Dass auf stern.de praktisch keine wertvollen Inhalte stehen, ist kein Versehen, sondern Absicht. Beim „Stern“ ist man überzeugt, dass das das Schlimmste wäre, das man tun könnte: Dinge mit Wert für den Nutzer kostenlos abgeben. Deshalb finden sich praktisch keine Inhalte aus der Zeitschrift auf stern.de. Und deshalb lassen sich die meisten „Stern“-Redakteure auch nicht dazu herab, für stern.de zu schreiben.
Erstaunlicherweise nennt stern.de-Chefredakteur Frank Thomsen sein Angebot dennoch ein „modernes journalistisches Angebot, das u.a. junge Zielgruppen an die Marke stern bindet und das Geld verdienen soll“. Woher Menschen, die Medien eher im Internet als auf Papier konsumieren, ahnen sollen, dass es sich beim „Stern“ nicht um eine Illustrierte handelt, in der eine Agenturmeldung an die andere gereiht wird, bleibt bei diesem Vorgehen, das man nicht einmal euphemistsich „Strategie“ nennen möchte, natürlich offen.
Das Online-Angebot des „Stern“ ist die Antwort des Verlags Gruner+Jahr auf die Frage: Was machen wir im Internet, wenn wir nichts im Internet machen wollen? Es ist der Versuch, mit überwiegend eingekauftem Allerweltsmaterial durch geschickte Verpackung ein eigenständiges Medium zu simulieren. Relevanz ist dabei verzichtbar, solange die Reichweite stimmt.
Und tatsächlich steigen gerade die Besucherzahlen von stern.de. Es ist der Rumpfproduktion offenbar gelungen, ihren aufgemotzten Agenturticker so zu präsentieren, dass er von Google und vielen Lesern tatsächlich versehentlich für ein eigenständiges journalistisches Angebot gehalten wird. Man muss sie für diesen Erfolg bemitleiden.
Nachtrag / Korrektur 18:35 Uhr. Ich hatte einen Artikel übersehen. Eine ganz exakte Zählung ist allerdings auch deshalb schwierig, weil stern.de das Veröffentlichungsdatum teilweise nachträglich zu ändern scheint.
(Schon als Kind habe ich mich beim Eurovision Song Contest mindestens so sehr für die Zahlen wie für die Musik interessiert. Früher habe ich meine Freunde und Eltern mit statistischen Auswertungen der Stimmen gelangweilt. Heute müssen die Leser dieses Blogs dran glauben.)
Es gibt eine sehr einfache Erklärung dafür, warum Aserbaidschan vor Italien den Grand Prix in diesem Jahr gewonnen hat. Die beiden Lieder waren ungefähr die einzigen, die sowohl Ost- als auch West-Europäern gefielen. Auf den Plätzen dahinter tun sich erstaunlich krasse Unterschiede in der Bewertung auf.
Ich habe einmal auseinandergerechnet, wie die klassischen und die neuen ESC-Länder abgestimmt haben. Das ist zwar weder eine scharfe geographische Trennung nach Ost und West, weil damit Griechenland, Zypern, Israel und die Türkei zum „Westen“ zählen, noch eine kulturelle, weil sich zum Beispiel die Türkei Aserbaidschan verbunden fühlt. Aber es mag als grobe Orientierung funktionieren. Das Ergebnis ist verblüffend unterschiedlich:
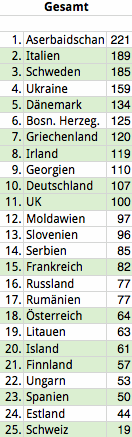
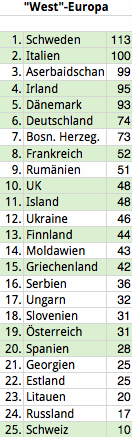
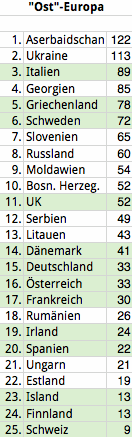
(Traditionelle, „westliche“ ESC-Länder sind farbig unterlegt.)
Es zeigt sich eine klare Präferenz von Osteuropäern für osteuropäische Kandidaten und Westeuropäern für westeuropäische Kandidaten, die sich meiner Meinung nach nicht allein durch die üblichen Nachbarschafts-Punkte erklären lassen, sondern unterschiedliche Geschmäcker reflektieren. Der Nu-Metal aus Georgien zum Beispiel kam im Osten hervorragend an und fiel im Westen komplett durch. Umgekehrt konnten die Osteuropäer mit dem Kinderliedpop aus Dänemark nichts anfangen, der den Westeuropäern gut gefiel.
Die bunten Plastikpopper Jedward aus Irland hatten vor allem deshalb keine Chance, weil sie in Osteuropa kaum Fans fanden. Auch Lenas Song stieß im Osten auf kaum Resonanz; die klassisch-kitschige Ballade aus Finnland wäre dort sogar auf dem vorletzten Platz gelandet. Im Westen hätte Schweden gewonnen, im Osten fast die Ukraine.
Für meine These, dass das nicht nur Ausdruck von Freundschafts- und Nachbarschaftpunkten ist, spricht das Abschneiden Rumäniens: Mit einer ausgesprochen harmlosen westeuropäischen Klavierpopnummer, die auf jede Art melodramatischen Ethnopop verzichtete, kam das Land im Westen deutlich besser an als im Osten.
Um den expandierenden Eurovision Song Contest zu gewinnen, muss man also „nur“ einen Auftritt hinlegen, der die Geschmäcker des Ostens wie des Westen gleichermaßen gut trifft ((Wie genau das Aserbaidschan und Italien geschafft haben, ist natürlich eine andere Frage)). Es muss nicht einmal der jeweilige Lieblingstitel sein; es genügt eine ansehnliche Zahl von mittelguten Wertungen. Aserbaidschan bekam gerade einmal aus drei von 42 Ländern die Höchstpunktzahl (Russland, Türkei und Malta), und auch nur aus vier Ländern zehn Punkte. Es war weniger eine überschwängliche Zustimmung, als ein breiter Konsens der Nicht-Ablehnung, der „Running Scared“ zum Sieg trug.
Die vom Publikum in der Halle rücksichtslos ausgebuhten Nachbarschaftspunkte sind dabei — selbst in einem Jahr ohne klaren Favoriten wie diesem — wieder einmal relativ bedeutunglos gewesen, so auffällig sie auch scheinen. Ja: Zypern hat Griechenland natürlich wieder zwölf Punkte gegeben, und San Marino wird daraus vermutlich mit Italien auch eine Tradition machen. Auch Deutschland hat die höchsten Punkte allesamt von Nachbarländern bekommen. Aber selbst ein Land wie Russland, das eigentlich am meisten von solchem Abstimmungsverhalten profitieren müsste, fällt mit einem schlechten Titel durch. Es mag für solche Länder mit vielen „Verbündeten“ leichter sein, einen Platz ganz am Ende zu vermeiden. Aber um nach vorne zu kommen, reichen diese Art Punkte nicht aus.
Nachtrag, 15:30 Uhr. In der ursprünglichen Version enthielten die Tabellen mehrere Fehler, die jetzt hoffentlich korrigiert sind.