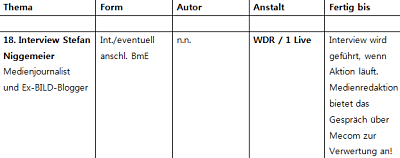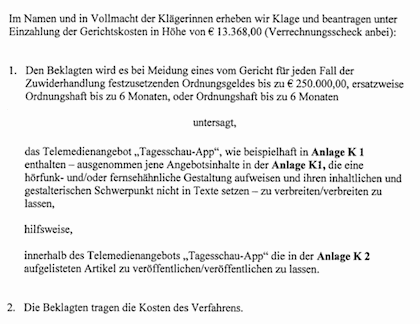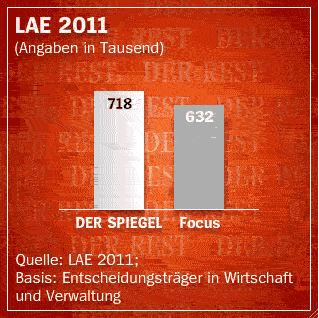Elmar Theveßen, der vom ZDF ernannte „Terrorismusexperte“, hat sich in einem ZDF-Blog über „selbsternannte Fernsehkritiker“ beschwert, die von seinen Auftritten am Freitag nach den Anschlägen in Norwegen nicht beeindruckt waren. Sie würden sich „Gesagtes für einen flockigen Artikel gern ein wenig zurechtbiegen“, meint Theveßen. Da ich in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ einen Artikel geschrieben habe, in dem Theveßen eine prominente negative Rolle einnimmt, fühle ich mich einfach mal angesprochen.
Elmar Theveßen, der vom ZDF ernannte „Terrorismusexperte“, hat sich in einem ZDF-Blog über „selbsternannte Fernsehkritiker“ beschwert, die von seinen Auftritten am Freitag nach den Anschlägen in Norwegen nicht beeindruckt waren. Sie würden sich „Gesagtes für einen flockigen Artikel gern ein wenig zurechtbiegen“, meint Theveßen. Da ich in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ einen Artikel geschrieben habe, in dem Theveßen eine prominente negative Rolle einnimmt, fühle ich mich einfach mal angesprochen.
Theveßen widerspricht der Kritik, sich vorschnell auf einen islamistischen Hintergrund festgelegt zu haben. Er schreibt:
Tatsächlich waren die norwegischen Sicherheitsbehörden am Freitag ziemlich überzeugt, dass Islamisten hinter den Anschlägen steckten (…).
Deshalb war die Arbeitshypothese der Behörden in Norwegen – Islamismus – eindeutig, ohne andere Möglichkeiten auszuschließen: Organisiertes Verbrechen, Rechtsxtremismus, Amokläufer. Genauso haben wir am Freitag berichtet und dabei Quellen genannt, Fakten von Vermutungen getrennt und auch die anderen möglichen Tätergruppen besprochen.
Schön wär’s gewesen. Im Gespräch mit Theveßen in der „heute“-Sendung um 19 Uhr kam die Möglichkeit, dass es sich nicht um Islamisten handelt, mit keinem Wort vor:

Petra Gerster: Bei mir im Studio ist jetzt Elmar Theveßen, unser Terrorismus-Experte. Elmar, wer könnte denn überhaupt als Urheber für diese Tat in Frage kommen?
Theveßen: Wir hatten heute am Nachmittag Kontakt mit norwegischen Sicherheitsbehörden. Und diese Behörden gehen davon aus, dass Al-Qaida oder islamistische Terroristen hinter diesen Anschlägen stecken. (…) Das sieht auch nach Sicht der Behörden nach einer organisierten Terrorwelle in Norwegen aus. (…) Wir wissen, dass ein führender Hassprediger in Norwegen seit vielen Jahren residiert. Und wir wissen auch, dass in der islamistischen Szene in Norwegen die Beteiligung an den Angriffen in Libyen in den vergangenen Monaten sehr viel Hass und Ärger und Wut verursacht haben.
Auch das „heute journal“, das um 22 Uhr begann, ging von einem islamistischen Hintergrund aus. Daran ließen schon die einleitenden Worte von Moderatorin Maybrit Illner keinen Zweifel:
Illner: Das ist ein bitterer Tag für Norwegen, und ein bitterer Tag für Europa. Der Terror ist zurück.
Das Gespräch mit Theveßen verlief dann so:
Illner: Und bei uns im Studio ist jetzt Elmar Theveßen, der ZDF-Terrorismusexperte. Elmar, die Polizei hat gerade bestätigt, dass diese beiden Taten in einem Zusammenhang stehen. Macht das die Suche nach dem Täter oder den Tätern leichter?
Theveßen: (…) Insofern [ist es] völlig möglich, dass ein einzelner Täter beide Taten verübt hat. Das heißt noch nicht, dass er nicht Helfer und Unterstützer hatte. Die Polizei sagte auch, dass man davon ausgeht, dass es sich bei diesem Mann um einen Norweger handelt, einen Mann nordischen Aussehens auch, und das nährt natürlich den Verdacht, dass es sich um eine lokale, örtliche Gruppe handeln könnte. Das hat auch die Polizei gesagt, ohne aber detailliert dann zu sagen, ob es auch islamistische Kreise innerhalb des Landes sein können oder politisch orientierte Gruppierungen – international organisierter Terrorismus scheint zunehmend unwahrscheinlich.
Illner: Und dennoch gibt es ja ein Bekennerschreiben.
Theveßen: Ja. Es gibt ein Bekennerschreiben. Das ist eine Gruppe, die sich auf den einschlägigen Foren im Internet zu Wort gemeldet hat, eine islamistische Gruppe, deren Namen man bisher nicht kannte. Und die bekennt sich zu diesen Anschlägen. Sie behauptet, dass sie zu tun hätten mit den norwegischen Soldaten, die in Afghanistan Dienst leisten, und auch mit Beleidigungen gegen den Propheten. Das heißt, es wurde zumindest der Eindruck erweckt, dass ein islamistischer Hintergrund da ist. Das ist auch nach wie vor nicht ausgeschlossen. Die Polizei gibt keine weiteren Details zum Täter derzeit bekannt, und insofern muss man die Ermittlungen abwarten.
Illner: In beiden Fällen erscheint es ein gezielter Angriff auf die norwegische Regierung zu sein, also muss man politische Gründe vermuten?
Theveßen: Davon geht die Polizei auch nach jetzigem Stand aus, dass es eher politische Gründe hat. Das könnte einerseits natürlich Islamismus sein, der Einsatz in Afghanistan beispielsweise, die massive Beteiligung Norwegens an den Luftangriffen in Libyen beispielsweise, im Rahmen der Nato-Einsätze, das alles hat in Islamisten-Kreisen für jede Menge Hass und Ärger gesorgt. Einer der führenden Hassprediger der Islamisten in Norwegen selber ist vor zwei Wochen angeklagt worden, hat wüste Drohungen gegen die Regierung ausgestoßen. Aber es gibt offenbar auch andere Bereiche in der Gesellschaft, die wegen einer Politik in der Welt auch massiv Wut und Ärger empfindet über die Politik dieser Regierung, auch da aus diesem Umfeld. Man will es nicht genauer qualifizieren, Rechtsextremismus möglicherweise, da ist die Polizei sehr vorsichtig, aber auch aus diesem Umfeld wären solche Angriffe vorstellbar.
Illner: Die letzte große Terrorwelle hat es in Schweden im letzten Jahr gegeben. Nun Norwegen. Warum konzentriert sich das auf Skandinavien, wenigstens möchte man den Eindruck haben?
Theveßen: Naja, momentan sagt die europäische Polizeibehörde, konzentriert es sich in der Tat auf Skandinavien. Wir hatten einen Anschlagsversuch in Stockholm, wir hatten Festnahmen in Norwegen. Wir hatten eine Festnahme auch in Kopenhagen. Islamisten gerade in diesen Ländern sind sehr stark, finden fruchtbaren Boden, um junge Leute zu rekrutieren. Aber, und hier liegt das große Fragezeichen, es ist eben nicht klar, ob es Islamistenkreise waren, die hinter diesen schrecklichen Attacken heute stecken.
Theveßens Thema an diesem Tag ist: Islamismus. Jedesmal, wenn das Gespräch für einen Moment auf eine der anderen Möglichkeiten schwenkt, bringt er es zum Islamismus zurück. Wenn die Polizei sagt, die Taten hätten wohl einen norwegischen Hintergrund, sagt Theveßen, das könnten ja auch islamistische Norweger sein. Wenn die Polizei sagt, man müsse die Ermittlungen abwarten, deutet Theveßen das als Aufforderung, solange weiter über einen islamistischen Hintergrund zu spekulieren. Nach der winzigen Andeutung, es könnten auch rechtsradikale Motive hinter den Anschlägen stecken, folgt erneut ein Ausflug in Häufung islamistischer Aktivitäten in Skandinavien. Das „große Fragezeichen“, das Theveßen ausmacht, ist bei ihm ein winziger Satzzeichenkrümel.
Das setzt sich auch am Ende der Sendung fort, als eigentlich Zeit genug vergangen wäre, um sich als Terrorismusexperte zu fragen, wie plausibel es ist, dass Islamisten ausgerechnet ein Massaker unter sozialdemokratischen Jugendlichen anrichten sollten.
Illner: Elmar, nochmal die Frage, wenn es sich dann eher um regionale oder gegebenenfalls eben nationale Täter handelt, ist damit die Spekulation um einen islamistischen Hintergrund perdü? Eher nein.
Theveßen: Die Polizei ist da sehr vorsichtig. Man muss noch den Hintergrund dieses Mannes erkunden, es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass derselbe Mann, der auf der Insel so viele Jugendliche getötet hat, auch derjenige ist, der in Oslo selber für das Bombenattentat heute verantwortlich ist. (…) Also, ganz ausgeschlossen ist nicht, dass er in Netzwerke eingeschlossen ist. Welcher Art diese Netzwerke sind, Islamisten oder nicht, das können nur die Ermittlungen der nächsten Tage zeigen.
Illner: Und insofern kann dieses Bekennerschreiben auch schlicht ein Fake gewesen sein?
Theveßen: Absolut möglich, dass es Trittbrettfahrer waren. Schon einmal haben wir ja eben gesagt, dass diese Gruppe bisher unbekannt war. Man weiß, dass Islamisten Skandinavien im Visier haben, insofern passt das alles zusammen. Auch die Sicherheitsbehörden, mit denen wir heute am Tag geredet haben, gingen erstmal deutlich von einem Al-Qaida-Hintergrund aus, weil alles zusammenpasste. Aber wir merken, dass jetzt im Internet beispielsweise in den Chat-Rooms, gerade Islamisten sich sehr freuen über diese schreckliche Tat, sie nutzen das für ihre eigene Propaganda und spornen momentan im Internet ihre Mitglieder an, selber auch aktiv zu werden. Wenn es denn am Ende sich herausstellt, dass dieses dann doch ein Islamist wäre, dann würde das umso mehr obendrein auch noch ein Propaganda-Erfolg für die Islamisten sein.
Illner: Wie groß ist, alles in allem, die Gefahr, dass Teile dieser Bewegung, Teile dieser Anschlagsserie auch Deutschland erreichen in irgendeiner Form?
Theveßen: Es hängt wirklich von diesem Hintergrund ab. Ist es ein Einzeltäter, der in der Lage war, all das vorzubereiten und durchzuführen, dann ist die Bedrohung für Deutschland natürlich gering. (…) Aber das Szenario, was wir heute gesehen haben, eine Bombenattacke mit einer Autobombe und dann einer Schießerei, das entspricht den Szenarien, die in den vergangenen Monaten Gegenstand von Terrorwarnungen in Europa, auch in Deutschland, gewesen sind, und die Sicherheitsbehörden sind überzeugt, dass ähnliche Planungen auch in Deutschland in Gange sind, aber ganz offenbar bisher nicht ausgeführt werden konnten. Also erhöhte Wachsamkeit, aber nicht notwendigerweise aus dem, was heute in Norwegen passiert ist, rückfolgern, dass auch in Deutschland Anschläge geschehen.
Illner: (…) Glauben Sie, dass das jetzt auch [in Skandinavien] zu einer zusätzlichen Alarmsituation führen wird?
Theveßen: Also, wir wissen, das die skandinavischen Behörden gerade im vergangenen Jahr sehr wachsam geworden sind. Weil sie gemerkt haben, Skandinavien steht im Visier islamischer Terroristen. Es gab mehrere Anschlagsversuche, nicht erfolgreich, Gott sei dank. Es gab eine Menge von Festnahmen. Aber man hat vielleicht auch zu sehr in diese Richtung geguckt – genau so wie man heute Nachmittag vermutete, aha, islamistischer Hintergrund. Und deswegen werden die Sicherheitsbehören in Skandinavien jetzt sehr genau hingucken, wer vielleicht noch in einer solchen Gesellschaft in Frage kommt, solche schrecklichen Angriffe durchzuführen.
Man hört es im Nachhinein förmlich Knirschen im Gebälk der Islamistenthese, die sich Theveßen zusammengezimmert hat. Sicher, sagt er, das Bekennerschreiben könnte falsch sein, aber es würde schon alles gut zusammen passen. Und ob es sich nun bei diesen Anschlägen um islamistischen Terror handelt oder nicht, ist fast egal, denn der islamistische Terror plant genau solche Anschläge wie diese.
Ganz am Schluss, im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Skandinavien besonders im Visier von Islamisten stehe, kriegt Theveßen die Kurve und deutet an, was im Kontext seiner völligen Fixierung auf Islamismus paradox wirken muss: Dass „man vielleicht auch zu sehr in diese Richtung geguckt“ habe. In seinem Blogeintrag erklärt er, wie er diesen winzigen Schlenker verstanden wissen will:
Schon im heute journal redeten wir über die Möglichkeit, dass die Sicherheitsbehörden und wir alle – nicht nur an diesem Tag, sondern auch längst vorher – zu sehr in nur eine Richtung geschaut hätten.
Und hier, als Vergleich zu dem oben dokumentierten Ablauf der Gespräche in „heute“ und „heute journal“ noch einmal, wie der Terrorismusexperte den Abend und seine Auftritte im ZDF-Blog erinnert:
Deshalb war die Arbeitshypothese der Behörden in Norwegen – Islamismus – eindeutig, ohne andere Möglichkeiten auszuschließen: Organisiertes Verbrechen, Rechtsxtremismus, Amokläufer. Genauso haben wir am Freitag berichtet und dabei Quellen genannt, Fakten von Vermutungen getrennt und auch die anderen möglichen Tätergruppen besprochen. Thema war auch das faktisch vorliegende Bekennerschreiben einer „unbekannten“ Gruppierung, die wir im ZDF aber als „mögliche Trittbrettfahrer“ qualifiziert haben. Dass wir dennoch am Ende nicht richtig lagen, ist ärgerlich – zumal auch bei früheren Anschlägen manchmal schnell falsche Annahmen die Runde machten: Nach den Anschlägen von Oklahoma City in Richtung Islamismus und nach denen von Madrid in Richtung ETA. In beiden Fällen aber geschah dies auf Basis der Informationen von Regierungs- und Sicherheitsbehörden. Solange diese Quellen genannt werden – wie bei uns geschehen – und auch ansonsten vorsichtig formuliert wird, war die journalistische Arbeit sauber.
Theveßen hat hier offenbar seinen Terrorismusexperten-Hut gegen seinen Stellvertretender-Chefredakteur-Hut ausgetauscht und bescheinigt sich selbst, „journalistisch sauber“ gearbeitet zu haben. Das heißt wohl soviel wie: Wir haben uns zwar komplett verfahren, aber immer die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten.
Außerdem, fügt er hinzu, habe das ZDF schon 2007 über die Gefahr der Islamhasser-Szene berichtet; zumindest bei Theveßen scheint das aber ja keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
Theveßens Blogeintrag ist ein pampiges „Wohl!“ oder „Selber!“ ohne eine Spur von Selbstkritik. Und vielleicht der beunruhigendste Gedanke ist der, den er gleich am Anfang formuliert:
Kreuzzügler oder Islamisten – wenn wir am Freitagnachmittag und -abend diese beiden Möglichkeiten als Hintergrund der brutalen Anschläge in Norwegen diskutiert hätten, dann hätten viele gesagt: „Die sind ja verrückt“.
Ich glaube nicht, dass Theveßen am Freitag überhaupt auf die Idee gekommen wäre, diese beiden Möglichkeiten zu diskutieren, dazu war er viel zu fixiert auf eine von beiden. Aber mit seiner Sorge, dann für verrückt gehalten worden zu sein, trifft er einen Kern des Problems: Die Medien sind viel zu sehr darauf bedacht, die (vermeintlichen) Erwartungen des Publikums zu erfüllen, und sie nicht mit Dingen zu konfrontieren, die sie nicht hören wollen. Das Publikum erwartet, dass die Medien (und zumal ihre „Terrorexperten“ mit Zugang zu privilegierten Informationen) ihnen unmittelbar nach einem solchen Anschlag sagen, wer dahintersteckt. Und natürlich haben viele Medien-Rezipienten denselben Reflex wie die Medien-Produzenten: Großer Bombenanschlag? Al-Qaida!
Es wäre eine erste gute Konsequenz aus dem kollektiven Medienversagen am Freitag, wenn der Gedanke Raum fände, dass eine wichtige Aufgabe von Journalismus in solchen Situationen wäre, den Wunsch des Publikums nach schnellen und einfachen Antworten zu enttäuschen. Nicht Wissen und Expertentum zu simulieren und nicht unmittelbar mit der Thesenproduktion zu beginnen. Und in Sätzen wie „Die Ermittlungen müssen abgewartet werden“ nicht Floskeln, sondern Handlungsaufforderungen zu sehen. Das wäre eine tolle Aufgabe für echte Terrorismusexperten in den Medien: Mit großer Beharrlichkeit dem Drängen der Moderatoren, sofort Antworten und Erklärungen parat zu haben, zu widerstehen, und als retadierendes Moment im Breaking-News-Hysterie zu funktionieren: „Nein, Frau Illner, man kann das wirklich noch nicht sagen / Es ist zu früh dafür / Wir wissen es noch nicht / Seriös lässt sich das nicht beantworten / Lassen Sie uns da nicht spekulieren.“
Ich bin kein Terrorismusexperte. Ich weiß nicht, was die norwegischen Sicherheitsbehörden, die am Freitagnachmittag Zeit fanden, mit der Terrorismusexpertenredaktion des ZDF zu sprechen, zu diesem Zeitpunkt wirklich annahmen. Offiziell haben sie sich nicht geäußert. Es liegt in der Natur des Journalismus, gerade auch Dinge herausfinden zu wollen, die (noch) nicht öffentlich und offiziell gemacht wurden. Aber Theveßen scheint auch im Nachhinein nicht auf die Idee zu kommen, dass es Situationen gibt, in denen es gute Gründe für Behörden gibt, unbestätigte Annahmen noch nicht öffentlich zu machen, und es dann auch gute Gründe für Journalisten geben könnte, solche Spekulationen zumindest nicht zur Grundlage für ihre Berichterstattung zu machen.
Es muss eine schmerzhafte Erkenntnis für die Theveßens der Welt sein, dass die Menschen am Freitag besser informiert gewesen wären, wenn es sie nicht gegeben hätte. „Expertise oder Spekulation?“ hat Theveßen seinen Blogeintrag überschrieben. Ich fürchte, er hält das für eine rhetorische Frage.
 Elmar Theveßen, der vom ZDF ernannte „Terrorismusexperte“, hat sich
Elmar Theveßen, der vom ZDF ernannte „Terrorismusexperte“, hat sich