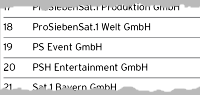Süddeutsche Zeitung
Der deutsche Grand-Prix-Vertreter Stefan Raab feiert vielleicht deshalb Erfolge, weil ihn an der Welt nur eines interessiert: Ob sie für einen Witz taugt.
· · ·
Stockholm, 10. Mai — Einer hat die Quelle entdeckt. Ein einziger, das genügt. Seine Kamera verrät ihn, er bleibt nicht lang allein. In Sekunden sind nach gutem Stoff hungernde Fernsehteams aus allen Ecken des Stockholmer Stadthauses zusammen geströmt und haben eine Oase gebildet. Der Mann in ihrer Mitte trägt, wie seine Freunde, eine wattierte penatenblaue Polyester-Jacke, die an die Ausgeh-Uniformen von Fußballern bei einer WM erinnern soll. Trotzdem wäre er unscheinbar, unrasiert wie er ist, mit Baseballkappe, Cargo-Hose und Turnschuhen, würden nicht sieben, acht Fernsehjournalisten, ihre Kameramänner und Mikrofonträger erwartungsvoll ihre Blicke auf den Mann richten, von dem sie wissen, dass er sie alle satt machen wird: Stefan Raab.
Es ist der Empfang des Bürgermeisters für die Teilnehmer des Europäischen Schlagerwettbewerbs, der an diesem Wochenende in Stockholm stattfindet. Wenige Zentimeter vor Raab, bedrängt von den Massen hinter ihm, steht ein junger schwedischer Reporter. Raab läuft jetzt wie aufgezogen. Nach jedem Satz zeigt er sein Nussknackergrinsen — ein breites, hölzernes Lächeln. „Na, bin ich lustig“, fragt dieses Grinsen, wenn er in die Runde schaut. Gerade erzählt er dem jungen Mann, der ihn anstrahlt, dass Wadde, Hadde und Dudde die drei meistverkauften Regale bei Ikea seien. „Das ist doch der ganze Witz bei meinem Lied Wadde hadde dudde da“, sagt Raab, legt den Kopf schief und schaut dem Reporter herausfordernd ins Gesicht, „wussten Sie das nicht?“ Kein Wort davon stimmt. Aber Raab hat großen Spaß, die Geschichte zu erzählen. Er hätte auch erzählen können, dass ihm der Text eingefallen ist, als er im Park sah, wie eine Frau mit ihrem Hund sprach. Aber das hat er schon zu oft erzählt. Und in Schweden jedenfalls passt die Ikea-Geschichte besser. „Die Hälfte von dem, was ich erzähle, von allem, was ich die ganzen letzten Jahre erzählt habe, ist erlogen“, sagt Raab. Er kann das ruhig sagen. Es wird keiner ankommen und sich beschweren. Aber wenn er die Wahrheit erzählte, und die Wahrheit langweilig wäre: dann würden sie sich beschweren.
Denn Raab ist Entertainer. Der erfolgreichste im Fernsehen heute. Seine wöchentliche Show TV Total hat erst Ostern wieder ihre eigenen Rekorde gebrochen und soll im nächsten Jahr gar täglich kommen. Seine Single Maschendrahtzaun wurde über eine Million mal verkauft und versorgte die Boulevardindustrie mit Stoff für Wochen. Raabs Musikfirma ist erfolgreicher als Große wie EMI und Ariola. Jetzt sorgt er dafür, dass sich junge Menschen massenhaft für eine alte, merkwürdige Erfindung interessieren: den Schlager-Grand-Prix.
Raab ist 33 Jahre alt und seit sieben Jahren im TV-Geschäft — die meiste Zeit auf dem Musiksender Viva, der ihn alles machen ließ. Er kann nicht nur moderieren und Faxen machen. Er kann singen. Spielt Gitarre, Schlagzeug, Klavier. Komponiert und produziert. Er braucht, wenn nicht mehr Zeit ist, nur zehn Minuten, um mit einem Musiker, den er noch nie getroffen hat, live so zu spielen, dass das Publikum tobt. Ein Grand-Prix-Journalist bittet ihn, ein finnisches Lied anzuspielen, Raab denkt zwei Sekunden nach, greift zur Ukulele, spielt einen Schlussakkord und sagt: „Finished!“ Das ist Handwerk, das beherrscht er. Warum heute aus jedem kleinen Stein, den er ins Wasser wirft, eine riesige Welle wird, erklärt es noch nicht.
Raab nimmt das Wort Entertainment wörtlich. Alles, was er macht, muss unterhalten. Zuerst ihn. Dann die Fans. Die Medien sowieso. Zu seinen Pressekonferenzen, die er nach jeder Probe in Stockholm abhalten muss, können die Programme blind Sendezeit buchen. Selbst wenn alle anderen nur erzählen, ob sie nervös waren, was sie mit ihrem Lied ausdrücken möchten und was sie vom Grand Prix erhoffen. Für die geht es ja um was: um ihre Karriere, um Auftritte in Europa, um Patriotismus gar. Für Raab geht es nur um eins: Spaß. Gewinnen macht Spaß.
Die alten Grand-Prix-Fans murren, weil sie ihre Institution nicht ernst genommen fühlen. Jens Bujar, Chefautor und Raabs wichtigster Mann, zuckt mitleidslos die Achseln: „Das ist Demokratie.“ Raab sagt: „Ich habe einen guten Geschmack“, dann korrigiert er sich: „einen breiten Geschmack.“
Raab hat nichts gegen den Grand Prix, genauso wenig wie gegen die Frau vom Maschendrahtzaun, Karl Moik vom Musikantenstadl oder Zlatko aus dem Big-Brother-Haus. Sie sind ihm egal. Sie sind Material für seine Witze. Mehr als jeder andere befreit Raab die Realität und die Fernsehrituale von allem Inhalt, bis nur noch Spaß übrig bleibt. Er kann eine halbe Stunde lang witzig mit einem schwedischen Model plaudern, ohne je zu fragen, für wen sie Modell steht und was der Beruf ihr bedeutet.
Wenn Raab eine Frau in schwedischer Tracht sieht, zeigt er auf sie, lacht und ruft: „Guck mal, was hat die denn auf dem Kopf!“ Vor sechs Wochen hat er sich ein Kickboard gekauft, eine Art moderner Tretroller. Sein Lieblingsspielzeug heute. Keiner kommt in den Backstage-Bereich, ohne es bewundert zu haben. Nach der Aufzeichnung seiner Show kann er es kaum erwarten, damit zum Hotel zurück zu fahren. Auf halber Treppe dreht er sich noch einmal um und lacht: „Das ist geil, beim Rückweg geht’s fast nur bergab.“
Raab ist ein Kind, privat und auf der Bühne. Auf der Bühne nimmt er den Spaß ernst. Die Mitarbeiter, die mit ihm die Filmbeiträge schneiden, müssen eine große Leidensfähigkeit haben: Er gibt die Beiträge nicht eher frei, bis alles perfekt ist. Wenn es nicht perfekt wird, schmeißt er es weg. Als er einmal Will Smith traf und versuchte, ihn nachzumachen, schaute ihn der Amerikaner mitleidig an und sagte: „You’re trying too hard.“ Das hat Raab zum Kern seiner Philosophie gemacht: Wenn etwas nicht leicht ist oder nach harter Arbeit leicht wirkt, lass es ganz.
Die Menschen haben auf einen wie ihn gewartet. Wenn er in der Sendung einen neuen Running Gag einführt, ein Kelle zum Beispiel, auf der das Wort „Respekt“ steht, dann sitzen schon in der nächsten Woche Leute im Publikum, die sich selber „Respekt“-Kellen gebastelt haben, andere halten „Respekt“-Fahnen hoch. „Die Leute sind aufmerksam und wollen was zum Mitmachen“, sagt Raab. In der Südkurve beim 1. FC Köln tragen die Fans alle tiefblaue Hemden mit dunkelblauen Krawatten, seit Ewald Lienen Trainer ist, der sich so anzieht und den Verein nach vorne brachte. Das gefällt Raab. Er steht nicht in der Südkurve. Nicht am Big-Brother-Haus, um „Manu raus“ zu brüllen. Und nicht am Maschendrahtzaun. Aber wie den Leuten, die dort stehen und feiern, ist ihm völlig egal, wie Manu wirklich ist und was die Frau vom Maschendrahtzaun tatsächlich umtrieb. Wie sie hängt er im privaten Gespräch „weisse?“ ans Ende seiner Sätze.
Seine Moderationen liest er nicht ab. Sie sind spontan, wirken oft entsprechend unpoliert. Das ist typisch für Raab: Er macht das einfach, weil er so ist, und es ist geschickt, als wäre es kalkuliert. „Die Leute schätzen es viel mehr, wenn du etwas spontan machst“, sagt er. „Wenn einer einen Witz erzählt und die Pointe mittelmäßig ist, finden Leute den Witz schlecht. Wenn da aber einer sitzt, der spontan seinen Kommentar abgibt, wirkt das viel witziger, selbst wenn der Spruch nur mittelmäßig war.“
Raab hat für die Journalisten in Stockholm eine Fahrt auf einem Wikingerschiff organisiert. Gegen Ende trifft er einen, für den der Grand Prix das wichtigste Ereignis des Jahres ist. Voll Stolz will der ihm eine kleine Zeitschrift in die Hand drücken, die Euro Song News des Grand-Prix-Fanclubs, deren Chefredakteur er ist. Aus dem Heft könnte Raab viel erfahren, was der Wettbewerb, an dem er teilnimmt, anderen bedeutet. Leider ist es nicht witzig. „Ich geb’s ihm später“, sagt Raabs Managerin entschuldigend dem schreibenden Fan. Raab ist längst gegangen. Er hat nicht mal gewartet, bis sie die Artikel über ihn gefunden hat.
 Man tut Fernsehsendern manchmal Unrecht. Dass diese Wok-WM, die Stefan Raab seit vier Jahren veranstaltet, randvollgestopft ist mit Werbung — das darf man wirklich nicht Pro Sieben in die Schuhe schieben. Denn Pro Sieben veranstaltet die Wok-WM nicht, sondern überträgt die Sendung nur. Pro Sieben wird diese Werbung auf den Leibchen, den Geräten, den Kulissen und in den Namen der teilnehmenden Teams, nur „aufgedrängt“, wie der Sender gegenüber epd Medien erklärte.
Man tut Fernsehsendern manchmal Unrecht. Dass diese Wok-WM, die Stefan Raab seit vier Jahren veranstaltet, randvollgestopft ist mit Werbung — das darf man wirklich nicht Pro Sieben in die Schuhe schieben. Denn Pro Sieben veranstaltet die Wok-WM nicht, sondern überträgt die Sendung nur. Pro Sieben wird diese Werbung auf den Leibchen, den Geräten, den Kulissen und in den Namen der teilnehmenden Teams, nur „aufgedrängt“, wie der Sender gegenüber epd Medien erklärte.