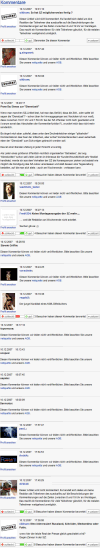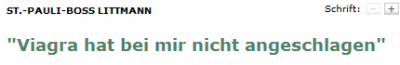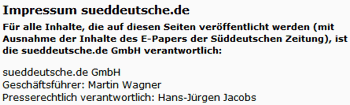Erstaunliche Zitate hat Thomas Mrazek für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Journalist“ von den Verantwortlichen führender deutscher Online-Medien eingesammelt. Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur von sueddeutsche.de, sagt auf die Frage nach den berüchtigten Bildergalerien seines Angebotes:
„Die Bildergalerien sind ein genuines Element des Internets. Wir können hier Geschichten über Bilder erzählen. Mit Klicks kann man sich verschiedene Erfahrungswelten erwandern — das ist Internet.“
(Meine Lieblingswanderung durch die Erfahrungswelten von sueddeutsche.de der vergangenen Monate führt übrigens durch eine Umfrage, die 237 Gründe für Sex ermittelt hat. Auf sueddeutsche.de sind sie vollständig dokumentiert, und raten Sie mal, wie oft Sie klicken müssen, um sie alle zu lesen.)
Der Chef vom Dienst bei sueddeutsche.de, Carsten Matthäus, sagt:
„Es gibt hier nicht die Devise: Macht jetzt Klicks — egal wie. Wir bemühen uns sehr darum, Qualität zu produzieren.“
Ganz ähnlich formuliert es „Spiegel Online“-Chef Mathias Müller von Blumencron:
„Es ist eine Unterstellung, dass uns nicht an Qualität, sondern an Klicks liegt.“
Okay, wenn es nicht um Klicks geht, vielleicht könnte jemand der „Spiegel Online“-Redaktion regelmäßige Betriebsausflüge ins Bordell spendieren? Oder, alternativ, kalte Duschen im Büro installieren?
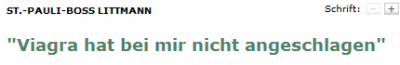


(Ein interessanter Versuch ist in diesem Zusammenhang auch das Spiel von Lukas, in dem man versuchen muss, Artikel-Überschriften von „Spiegel Online“ und Bild.de der richtigen Quelle zuzuordnen.)
Blumencron kritisiert im „Journalist“ eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Abwege der Onlinemedien. In „Klicks, Quoten, Reizwörter: Wie das Web den Journalismus verändert“ kommen die Journalisten Steffen Range und Roland Schweins u.a. zu folgendem Schluss:
Wie in Trance folgen die meisten Online-Redaktionen dem Leitmedium „Spiegel Online“ und seinem Kanon eines neuen, leichtlebigen, unterhaltenden, tendenziösen Netzjournalismus. Dabei geben die Journalisten ohne Not jahrzehntelang bewährte journalistische Prinzipien preis. Sie begehen Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Denn die meisten werden den Internet-Konzernen nicht Paroli bieten können, selbst wenn sie noch so viele Rätsel, Bildergalerien und Telefon-Tarifrechner auflegen. Das Massengeschäft gehört längst Google und den Unterhaltungsportalen.
Blumencron erwidert im „Journalist“:
„Die Autoren haben schlecht recherchiert. Sie haben nie Kontakt mit uns aufgenommen, dabei sind unsere Türen immer offen.“
Er wirft der Untersuchung vor, sich auf veraltete Quellen aus den Jahren 2001 und 2003 zu stützen — zweifellos eine ungerechtfertigte Kritik. Die Autoren reagierten darauf ausgesprochen aufgebracht und fordern in ihrem Blog eine Entschuldigung von Blumencron.
Ich fürchte, die werden sie nicht bekommen. Ich habe Blumencron gefragt, ob er mir ein Beispiel für schlechte Recherche schicken und erklären mag, wie er das mit den veralteten Quellen meint. Statt einer Antwort leitete er er mir eine Mail weiter, die er bei Erscheinen der Studie an die Verfasser und die Stiftung geschickt habe. Darin heißt es u.a.:
[…] Meinen wir, wenn wir von Spiegel Online reden, wirklich dieselbe Web-Site?
In munterer Sprache ziehen Sie über die Online-Redaktionen her und da wir bereits im Vorwort sehr prominent erwähnt werden, kann der Leser gar nicht umhin, Ihre Aussagen auch auf unsere Site zu beziehen. Sie haben uns sogar ein eigenes Kapitel gewidmet, nur frage ich mich: Warum ist keiner von Ihnen während der Recherchen zu Ihrer — immerhin als gewichtige Studie gepriesenen — Ausarbeitung bei uns vorbeigekommen, um sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen? Vielleicht hätten Sie dann einen Teil der gravierenden Fehlaussagen vermeiden können, die Ihre Studie kennzeichnen. […].
Sie schreiben, der Leser würde kurze Meldungen den ausgefeilten Analysen, Reportagen und Hintergrundstücken vorziehen – und deshalb würde die Formenvielfalt des klassischen Journalismus bei uns nicht stattfinden. Das Gegenteil ist der Fall – und Sie hätten es leicht an unserem Produkt und unserer Statistik überprüfen können. Gerade auf diese Formen legen wir großen Wert, mehr als die meisten Tageszeitungen. Warum schicken wir sonst Reporter nach Bangla Desh, um vor Ort zu recherchieren, wie die Menschen dort der drohenden Überflutung ihres Landes entgegensehen?
Warum waren wir sofort in Kunduz und haben dort mit Reportagen nicht nur über die Stimmung im Bundeswehr-Lager berichtet, sondern auch als einzige über die von deutschen Medien galant übersehenen afghanischen Opfer des Anschlags? Warum setzen wir ein ganzes Team daran, das Abkassieren der Versorger beim Trinkwasser zu untersuchen, was umgehend zu hektischen Aktivitäten von Kartellwächtern und Politikern führte? (Alles Beispiele aus den vergangenen Tagen).
Warum installieren wir eine feste Korrespondentin in Beirut? Und warum besteht ein Großteil unserer Aufmacher gerade nicht aus News, sondern aus politischer Analyse, aus Autorenstücken, etliche davon von Spiegel-Kollegen? Sind das wirklich die Merkmale eines „zerstreuenden Journalismus“?
Natürlich sind wir noch lange nicht perfekt. Natürlich vergreifen wir uns mal mit einer Headline im Ton. Natürlich liegen wir mal mit einem Thema daneben, wo kommt das nicht vor. Und ja, wir bekennen uns zur Unterhaltung, dafür haben wir ein Ressort Panorama, in dem fünf unserer über sechzig Redakteure arbeiten. Ist das wirklich eine Ressourcenverteilung, die sich am „Primat der Unterhaltung“ orientiert?
Sie schreiben, dass wir unsere Reichweite (die Sie merkwürdigerweise an der Zahl der Klicks messen) krampfhaft mit Bilderstrecken hochtreiben würden — wiederum falsch beobachtet. Die Reichweite — also die Zahl unserer Leser — wird von der Agof und von Allensbach mittlerweile konservativ, aber recht verlässlich ermittelt. Sie hat nichts, aber auch gar nichts mit der Zahl der Klicks zu tun. Auch für das Werbegeschäft sind die meisten Bilderstrecken irrelevant — sie sind schlicht nicht vermarktbar und werden dem Kunden auch nicht als vermarktbare Klicks kommuniziert. Warum leisten wir uns dennoch eine Bildredaktion aus drei Kollegen und bauen ein gemeinsames achtköpfiges Video-Team mit SpiegelTV auf? Weil wir ein visuelles Medium sind und etliche Sachverhalte über Bilder besser deutlich machen können, als mit tausend Worten.
Der schlimmste Vorwurf indes ist jener, dass wir munter die Grenzen zwischen Werbung und Inhalt verwischen. Sie hätten sich überzeugen können: Bei uns sind Vermarktung und Redaktion scharf getrennt, kein Redakteur textet bei uns auch nur eine Zeile im Auftrag eines Werbekunden. Dagegen habe ich selbst Verträge etlicher renommierter Tageszeitungen gesehen, in denen Interviews, Reportagen und Gefälligkeitsdienste für den Kunden ausdrücklich zugesichert wurden. […]
Falls Sie sich also weiterhin mit Spiegel Online befassen wollen — etwa in Ihrem „Blog für Qualitätsjournalismus“ — lade ich Sie nach Hamburg ein. Dort können Sie sich gern davon überzeugen, dass unsere Redaktion kein „Totenschiff“ ist, sondern die derzeit am schnellsten wachsende Qualitätsredaktion in Deutschland, eine hoch motivierte, gut ausgebildete, gut bezahlte und selbstbewusste Mannschaft. […]
Diese Mail ist inzwischen mehrere Monate alt. Ich dokumentiere sie — mit freundlicher Genehmigung von Herrn Blumencron — trotzdem, weil ich glaube, dass die Grundsatzdiskussion interessant und relevant ist. Am Konflikt hat sich ohnehin wenig geändert, und die Schere zwischen der Kritik an den Seiten vermeintlicher Qualitätsmedien und ihrer Selbstdarstellung wird gerade eher noch größer.
Das liegt sicher auch daran, dass wir Kritiker uns manchmal zu sehr in den Bildergalerien und Sexgeschichten verhaken und darüber tatsächliche und fundamentale Qualitätssteigerungen übersehen.
Andererseits: Wie ernst kann man Blumencrons Empörung über den Vorwurf der Vermischung von Werbung und Inhalt nehmen, wenn „Spiegel Online“ seit Jahren nicht gekennzeichnete Werbelinks wie diesen hier innerhalb der redaktionellen Menuleiste anbietet:

Oder versuchen Sie mal, in der fröhlich als „Angebote“ markierten Linksammlung auf der Startseite von „Spiegel Online“ redaktionelle Links, Eigenwerbung und bezahlte Angebote auseinander zu halten:

Diese Mischung ist nicht nur ethisch zweifelhaft, sondern auch juristisch: Das Berliner Kammergericht urteilte im vergangenen Jahr, dass ein Besucher vor dem Klick wissen müsse, ob er auf eine Werbeseite kommt. Müsste das nicht eine Selbstverständlichkeit sein für ein Qualitätsmedium?
Bemerkenswert ist auch, was Martin Rieß, Verkaufsleiter beim „Premiumvermarkter“ Quality Channel (u.a. sueddeutsche.de, „Spiegel Online“) auf dem Medienforum Mittweida gesagt hat. Er wurde angesprochen auf redaktionell gestaltete Seiten, die Werbekunden glücklich machen sollen, so zum Beispiel die berüchtigten Rubriken Sommerreifen-Spezial und Winterreifen-Spezial, die während der Reifenwechselzeiten von Continental gesponsert werden und für die zunächst bei „Spiegel Online„, heute noch bei sueddeutsche.de (pseudo-)journalistische Artikel vom Fließband produziert werden mussten. Rieß sagte:
Rieß: „Die Meßbarkeit im Internet ist Fluch und Segen zugleich. […] Es ist natürlich ein Fluch, weil wir dann sehen, dass beispielsweise drei Tage vor Ablauf des Winterreifenspezials eben noch sehr viel [an Klicks] fehlt, und dann versuchen wir schon mit den Redaktionen, da Möglichkeiten zu finden, noch …“
Moderatorin: „Das würde uns näher interessieren. Das heißt, Sie nehmen dann Einfluss auf die Redaktionen?“
Rieß: „Nein, naja, wir versuchen, ihn zu nehmen. Die Redaktionen sind natürlich, je nachdem, wie selbstbewusst oder stark die sind, in der Lage zu sagen: Ist uns völlig egal, ob das Winterreifenspezial unterliefert oder nicht. Aber wir weisen darauf hin, dass es Probleme gibt, was Leistungserfüllung anbelangt. Und man kann dann natürlich einen Artikel auf die Homepage nehmen oder auch ein bisschen verstecken. Das kann jede Redaktion für sich entscheiden, aber man kann natürlich so steuern, dass sich die Werbekunden da… eher… .“
Hier endet der Satz.
Das ist der Stand der Dinge: Die Online-Medien mischen Werbung und Redaktion und zwingen ihre Leser dazu, dutzendfach zu klicken, um einen einzigen Artikel zu lesen, und empören sich darüber, dass man ihnen vorwirft, Werbung und Redaktion zu mischen und ihre Leser als Klickvieh zu missbrauchen.