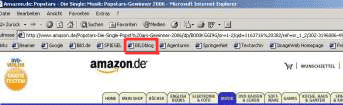Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Deshalb unterstützt „Bild“ den Papst. Chefredakteur Kai Diekmann über den erstaunlichen neuen Katholizismus einer Boulevardzeitung.
Im November vergangenen Jahres reist eine Delegation der „Bild“-Zeitung nach Rom. Chefredakteur Kai Diekmann überreicht Papst Johannes Paul II. im Rahmen einer Privataudienz eine Bibel — ein Exemplar der sogenannten „Volksbibel“, die das Blatt zusammen mit dem Weltbild-Verlag eine Viertelmillion Mal verkaufen wird. Diekmann verspricht dem Oberhaupt der katholischen Kirche: „Mit über zwölf Millionen Lesern täglich ist uns auch die Verbreitung der christlichen Glaubensbotschaft ein ernstes Anliegen.“
Ungefähr seit diesem Tag versucht „Bild“, sich als papsttreueste Zeitung der Welt zu positionieren. Sie feiert Worte und Werke Johannes Pauls II., sie hängt an seinen Lippen, sie berichtet in großer Detailtreue (wenn auch nicht immer zutreffend) über jede neue Wendung in seiner Krankengeschichte. Als andere davon ausgehen, daß der Papst vorübergehend nicht sprechen kann, befürchtet sie, er sei für immer stumm. Als er dann doch wieder ein paar Worte sagen kann, nennt sie es ein Wunder. Wer die Politik des Vatikans kritisiert, zum Beispiel das strikte Verbot, im Kampf gegen Aids auch Kondome benutzen zu dürfen, wird von „Bild“ als durchgeknallt dargestellt und in der Rubrik „Verlierer des Tages“ oder der Kolumne von Franz Josef Wagner abgewatscht.
Die „Bild“-Zeitung hat einen Mitarbeiter in Rom, der eine Biographie über den Papst verfaßt hat und den sie ihren „Vatikan-Korrespondenten“ nennt. Wenn er schreibt, zeigt sie häufig ein Bild von ihm, in dem er vor dem Papst kniet. Als der Papst stirbt, tritt dieser Vatikan-Korrespondent in verschiedenen Fernsehsendungen auf und weint mehrfach. Auch noch Tage nach dem Tod des Papstes übermannen ihn seine Gefühle. Seine Zeitung führt unterdessen die „Wunder“ auf, die Papst Johannes Paul II. angeblich bewirkt habe, und fordert quasi seine sofortige Heiligsprechung.
Als Kardinal Ratzinger gewählt wird, titelt „Bild“: „Wir sind Papst“. Die Zeitung berichtet, daß Ratzingers Eltern Joseph und Maria „waren“. Sie kritisiert, daß der neue Papst „in keinem Land der Welt so unerbittlich kritisiert“ werde wie in Deutschland und daß britische Zeitungen übel gegen ihn „hetzten“, die seine Jugend im Dritten Reich unangemessen groß in den Mittelpunkt rücken. Daß diese Blätter über die Mitgliedschaft Ratzingers in der Hitler-Jugend berichten, nennt „Bild“ einerseits eine „Beleidigung“, betont aber andererseits, niemand müsse sich dafür „schämen“, Hitler-Junge gewesen zu sein. In ihrem Eifer verleugnet „Bild“ sogar die Existenz eines KZ in der Nähe von Ratzingers Heimat Traunstein.
Der strenge Katholizismus wirkt sich auch auf die Berichterstattung jenseits des Vatikans aus. Massiv kämpft „Bild“ gegen den Beschluß der Berliner SPD, konfessionsungebundenen Werteunterricht an den Schulen einzuführen, und veröffentlicht „Zehn ‚Bild‘-Gebote für alle Politiker“, in denen es unter anderem heißt: „Du sollst deinen Amtseid auf Gott schwören“ und: „Du sollst das Gottvertrauen, das Kinder haben, nicht aus ihren Seelen vertreiben.“ Sie kommentiert eine Demonstration von deutschen Moslems gegen Gewalt mit den Worten: „Schön, daß das auch andere, die in unserer freiheitlichen Gesellschaft mit uns leben, genau so sehen.“ Sie illustriert Überlegungen, einen islamischen Feiertag in Deutschland einzuführen, mit einer Fotomontage, in der Tausende Moslems vor dem Reichstag beten.
Nicht verändert hat sich die Position von „Bild“ in anderen Fragen. Gegner der „Bild“-Zeitung werden weiter mit heiligem Zorn und nicht selten falschen Anschuldigungen verfolgt, Unschuldige zu Tätern gemacht und Schwache zu Witzfiguren, und weder die sexsüchtigen halbnackten Frauen von Seite eins noch die Prostituiertenanzeigen hinten im Blatt traf bisher ein Bannstrahl.
Über die neue Religiosität von „Bild“ wollten wir mit Chefredakteur Kai Diekmann reden. Ein persönliches oder telefonisches Interview lehnte er „aus Zeitgründen“ ab. Möglich war nur, ihm Fragen zu schicken, die er schriftlich beantwortete. Nachfragen konnten nicht gestellt werden.
Die „Süddeutsche“ nannte „Bild“ am Freitag einen „Osservatore Tedesco“. Fühlen Sie sich wohl oder unwohl mit dieser Beschreibung?
Das ist ein Kompliment: Der „Osservatore Romano“, die Zeitung des Vatikans, hat in seiner Heimat eine Reichweite von einhundert Prozent. So weit sind wir leider noch nicht.
„Wir sind Papst“, hat „Bild“ am Mittwoch getitelt. Wer sind „wir“? Wir Deutschen? Wir deutschen Katholiken? Die „Bild“-Redaktion?
Wir alle. Und ich bin mir ganz sicher: Sie von der „Sonntagszeitung“ doch hoffentlich auch?
Wem ist diese Schlagzeile eingefallen?
Meinem Kollegen Georg Streiter. Er ist Politikchef bei „Bild“.
Die „Bild“-Zeitung hat sich in den vergangenen Monaten als besonders papsttreue Zeitung positioniert. Warum?
Weil ehrwürdige Institutionen sich unterstützen müssen.
Welche Bedeutung hatte die Audienz der „Bild“-Führungsriege beim Papst für Sie?
Eine große Ehre, eine sehr bewegende Begegnung.
Glauben Sie an Gott? Sind Sie katholisch?
Ja.
In den Grundsätzen und Leitlinien von Axel Springer fehlt ein Bezug auf das Christentum. Glauben Sie, daß eine Ergänzung sinnvoll wäre? Oder versteht es sich ohnehin von selbst, daß die Medien der Axel Springer AG sich den abendländisch-christlichen Werten verpflichtet fühlen?
Anima naturaliter Christiana*.
Die „Bild“-Zeitung berichtet seit einigen Monaten viel stärker als früher über kirchliche Themen, betrachtet auch gesellschaftliche Fragen häufiger aus religiöser, insbesondere katholischer Sicht. Nehmen Sie damit eine Stimmung in der Bevölkerung auf? Oder versuchen Sie umgekehrt, die Bevölkerung zu beeinflussen, quasi zu missionieren?
Jeden Montag heißt unsere Mission „Bundesliga“, im Sommer sind wir auf der Mission „Bikini“, und 365 Tage im Jahr missionieren wir für besseres Wetter. Im Ernst: Wir missionieren nicht, wir berichten, was ist.
Ist der „Bild“-Leser katholisch?
Die „Bild“-Leser sind Katholiken, Protestanten, Moslems, Juden, Atheisten und so weiter. Frei nach dem Neuen Testament: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Sie haben sich im vergangenen Jahr ausdrücklich zu Kampagnen als legitimem und positivem Mittel einer Boulevardzeitung bekannt. Ist der Katholizismus nur die aktuelle Kampagne der „Bild“-Zeitung, die in wenigen Monaten durch eine andere abgelöst wird?
Große Ereignisse verdienen große Schlagzeilen, wie nach der erfolgreichen Landung von Apollo 11: „Der Mond ist jetzt ein Ami“.
Im ersten Quartal 2005, das schon von vielen Berichten über Johannes Paul II. geprägt war, ist die Auflage der „Bild“-Zeitung weiter gefallen. Läßt sich mit dem Papst und Themen der katholischen Kirche womöglich gar keine Auflage machen? Würden Sie das in Kauf nehmen als Preis dafür, eine im Sinne der katholischen Kirche und ihrer Werte bessere Zeitung zu machen?
Ich kann Ihre Frage nur mit einem eindeutigen „je nachdem“ beantworten.
Ihr Kolumnist Franz Josef Wagner hat in seiner Kolumne in dieser Woche gemutmaßt, Gott habe den Deutschen „diesen Papst geschenkt, damit wir endlich aufhören, an falsche Götter zu glauben“. Glauben Sie das auch?
Jeder Kolumnist soll nach seiner Fasson selig werden.
Für die Kirche, nicht nur die katholische, ist Keuschheit eine Tugend. Für die „Bild“-Zeitung offensichtlich nicht. Müßte eine Zeitung, die nicht nur in ihrer Berichterstattung über den Papst, sondern auch in der Bewertung aktueller politischer Streitfragen die Prinzipien der Kirche und des christlichen Glaubens als Maßstab anlegt, aufhören, jede versehentlich herausgerutschte weibliche Brustwarze überlebensgroß abzubilden und zu feiern?
Ich glaube, wir müssen uns mal zusammen in der Sixtinischen Kapelle Michelangelos Deckenfresko anschauen. Nackt kommst du auf Erden, nackt wirst du von ihr gehen.
Wie christlich kann eine Boulevardzeitung überhaupt sein? Sehen Sie nicht die Gefahr, je mehr Sie sich als papsttreueste Zeitung positionieren, desto pharisäerhafter zu erscheinen?
Wir alle sind Sünder, ausgenommen natürlich die Kollegen von der Sonntagspresse: Wer am Tag des Herrn das Wort verkündet, tut dies natürlich mit reiner Seele.
Glauben Sie, daß sich Kritik am (neuen) Papst per se verbietet?
Ach, Bruder Niggemeier . . .
Mißbraucht „Bild“ das Pathos der katholischen Kirche und letztlich den Glauben nicht, um in einer Zeit, in der alles beliebig erscheint, sich mit scheinbarer Bedeutung aufzuladen?
Jetzt werden Sie mir etwas zu protestantisch.
Welches ist Ihr Lieblings-Gebot?
Bei dieser Frage möchte ich das Beichtgeheimnis in Anspruch nehmen.
Welches christliche Gebot ist für eine Boulevardzeitung am schwierigsten in der Praxis zu beherzigen?
Du sollst nicht stehlen. Eine alte Journalistenweisheit besagt nämlich: Besser gut geklaut, als schlecht erfunden . . .
Welche christlichen Werte sind Ihrer Meinung nach heute besonders wichtig?
Glaube, Liebe, Hoffnung.
Was antworten Sie gläubigen Christen, die sich daran stoßen, daß „Bild“ Anzeigen von Prostituierten veröffentlicht?
„Bild“-Volksbibel, Seite 1046. Für alle anderen: Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 7.**
*) „Die Seele ist natürlicherweise christlich“, mit anderen Worten: das Christentum ist genau das, was der Mensch im Innersten sucht. Wort des Kirchenführers Tertullian, 197 nach Christus.
**) „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“