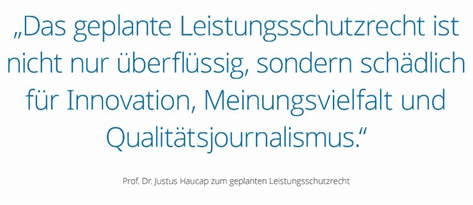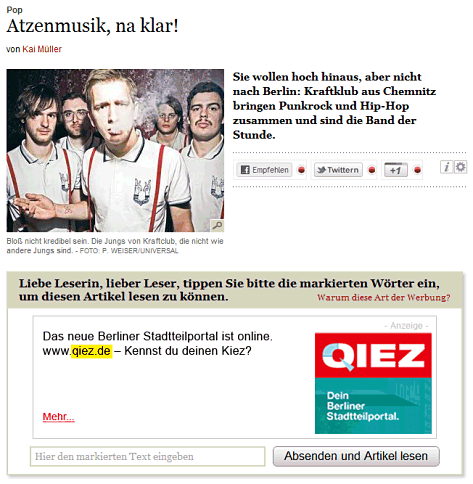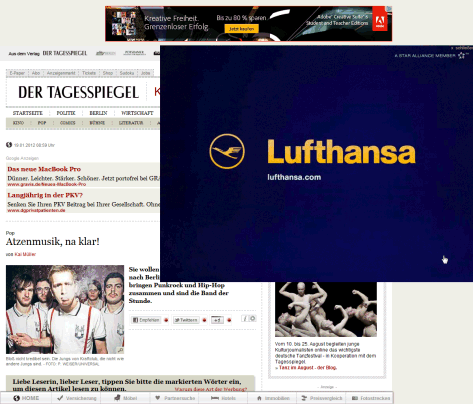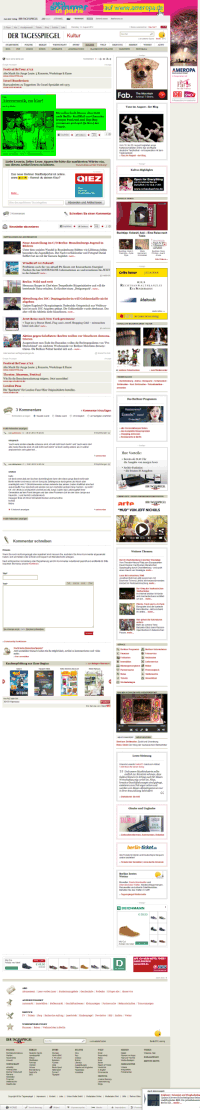Man kann es sich natürlich so einfach machen wie Udo Grätz, der stellvertretende Chefredakteur des WDR. Der twitterte als Reaktion auf meinen Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über die wachsende Kritik an den etablierten Medien:
Weiterhin. Er hätte angesichts der vielstimmigen und keineswegs immer unbegründeten Kritik an der Arbeit auch seiner Redaktionen wenigstens sagen können: „Noch präziser arbeiten“, aber selbst das war wohl schon zuviel verlangt.
Nicht beirren lassen, das ist eine Reaktion auf den spürbaren Gegenwind, den die Mainstream-Medien derzeit erfahren. Was mich, je nach persönlicher Stimmung, wütend macht oder besorgt, ist diese Selbstgewissheit, die aus manchen Reaktionen etablierter Medien auf die Kritik spricht (und natürlich vor allem auch den Nicht-Reaktionen); die Überzeugung, dass man sich nichts oder jedenfalls nichts Gravierendes vorzuwerfen hat; die Diffamierung der Kritik als von Russland gesteuert.
Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kommentatoren von Russland gekauft sind, so wenig wie ich weiß, wie viele Journalisten von den Vereinigten Staaten gekauft sind. Vielleicht bin ich da naiv, wenn ich in beiden Fällen die jeweilige Verschwörungstheorie so lange für unwahrscheinlich halte, wie ich das Verhalten der Betroffenen auch anders erklären kann.
Und es sind ja, im Fall der Kritiker, nicht nur irgendwelche anonymen „Trolle“, die das Gefühl haben, dass sie von den Medien nicht umfassend informiert werden. Es sind nicht nur die Paranoiker und Leute, die mit Hysterie Geschäfte und Politik machen wie Ulfkotte und der Kopp-Verlag oder die Bindestrichphobiker von den „Deutschen Wirtschafts Nachrichten“. Es sind zum Beispiel auch die Nachdenkseiten von Albrecht Müller, die einer politischen Nähe zu Kopp & Co. unverdächtig sind. Und es sind, glaube ich, tatsächlich unauffällige, politisch interessierte und zunehmend von den Mainstream-Medien desillusionierte Menschen.
Ein Leser schreibt mir:
Ich selbst gehöre auch zu den Einwohnern Deutschlands, deren Vetrauen in die Medien dieses Landes in den vergangen Wochen besonders gelitten hat. Um jegliches Missverständnis auszuräumen: Ich habe nie in einem Internetformum oder im Kommentarbereich irgendwelcher Medien Beiträge gepostet oder mich als Troll betätigt.
Ich habe mir einfach nur eine kritische Berichterstattung zu den Dingen gewünscht, sei es in der Ukraine, Syrien oder von einem der sonstigen Kriesenherde der Welt.
Als besonders frustrierend dabei habe ich empfunden, wie Medien teilweise die von den Zuschauern/Lesern angebrachte Kritik beim Thema Ukraine aufgenommen haben: Als Antwort darauf wurden auch auf den Seiten der FAZ Artikel darüber veröffentlicht, dass vom Kreml gesteuerte Agenten die Foren zumüllen und Propaganda betreiben. Nicht gerade das was man souverän nennt.
Ich selbst hatte vor einigen Jahren das Buch von Peter Scholl Latour über Russland gelesen. Meine Meinung zum aktuellen Konflikt fußt wesentlich auf diesem Buch. Mir dann pauschal zu unterstellen, ich wäre mit meinen Ansichten Opfer oder gar Teil eines von Moskau gesteuerten Netzwerks, finde ich schon ein besonders starkes Stück. Wie soll ich dann solchen Institutionen Vetrauen schenken? Man wundert sich eben.
Auf Twitter schrieb mir jemand:
Ich habe mich erkannt. Ich bin in den 80ern in der BRD aufgewachsen. Grundkoordinate war, dass „wir“ die „Guten“ sind, nicht die DDR. Ich habe am 2. Mai das Odessa Massaker im Livestream gesehen, wie aus Fenstern Fallende am Boden liegend tot geschlagen wurden. Die deutschen MSM [Mainstream-Medien]: Bei einem Unglück (!) sind auf unbekannte Weise (!) durch einen Brand (!) Menschen verstorben. Das hat alles, an was ich geglaubt habe (wir sind die Guten!), zerstört und eine lodernde Wut entfacht, die bis heute andauert.
Marco Herack schrieb schon im April in seinem FAZ.net-Blog „Wostkinder“:
Und fürwahr, es gab in den letzten Jahren wohl nur wenige Diskurse, in denen die Meinung zwischen den Gatekeepern und den Bürgern soweit auseinanderging wie in Bezug auf die Ukraine. Während die Artikel klar gen bösen Putin weisen, erschöpfen sich viele Leserkommentare in genau dem Gegenteil. Nicht Putin ist der Böse, man äußert ein gewisses Verständnis und zweifelt an dem Treiben der eigenen Regierung. Umfragen deuten darauf hin, dass es sich hierbei keineswegs um Russen handelt, die im Auftrag von Putin die Kommentarspalten bevölkern. Die öffentliche Meinung, die Bürger dieses Landes, sind schlichtweg anderer Meinung und äußern sie.
Die Reaktion auf diese andere Meinung der Bürger war im Politik-Bereich dieser Zeitung genau das, was man der Lesermeinung vorwarf. Verschwörungstheorie, geäußert von Julian Staib. Aber auch andere Zeitungen zogen nach, zum Beispiels Jens Bisky in der Süddeutschen. Das zeigt vor allem, dass man nicht bereit ist den Fehler bei sich selbst zu suchen. Und warum Worte wie „Systemmedien“ in Mode sind. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Bestsellerlisten Büchern führen, die davon handeln, dass Meinungen unterdrückt werden.
Einer dieser Bestseller ist Udo Ulfkottes Buch „Gekaufte Journalisten“, kommende Woche auf Platz 6 der „Spiegel“-Liste. Ulfkotte ist in vielerlei Hinsicht irre, aber ich halte es für falsch, so zu tun, als gäbe es ihn nicht und als wäre sein Buch kein Erfolg. Es enthält neben absurden Übertreibungen und Verdrehungen bekannte, aber tatsächliche journalistische Skandale, und die atemberaubende Mischung aus beidem macht das Buch brisant und für manchen Leser womöglich glaubwürdig.
Ein anderer Bestseller ist „Wir sind die Guten“ von Mathias Bröckers und Paul Schreyer. Es stellt viele unbequeme Fragen, an die Rolle der Amerikaner und des Westens im Ukraine-Konflikt — vor allem aber auch an die Medien, die diese Rolle so wenig hinterfragen. Es ist von seiner Haltung und seinem Tonfall mit Ulfkottes Pamphlet nicht zu vergleichen, aber es hinterlässt umso mehr das Gefühl, dass es hier eine Leerstelle gibt in der Berichterstattung der etablierten Medien.
Und dieses Gefühl wird dadurch verstärkt, dass es in eben jenen Medien keine große Auseinandersetzung gibt über das Buch. Dass es nicht als Anlass gesehen wird, sich mit den Fragen, die es aufwirft, auseinanderzusetzen — und sei es, sie nüchtern und klar zu beantworten und der Analyse zu widersprechen.
Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß sehr wenig über die Ukraine, und ich bin — anders als gefühlt erstaunlicherweise jeder andere — kein Experte für ukrainische Geschichte, russische Psyche oder die Grenzen des Völkerrechts. Umso mehr bin ich darauf angewiesen, Menschen, die darüber berichten, zu vertrauen. Es gibt vielleicht Dinge, die ich nachprüfen kann, und Aspekte, die mit meinem Vorwissen übereinstimmen. Aber am Ende bleibt ein großer Teil, bei dem ich einem Augenzeugen, einem Reporter, einem Kommentator, einem Medium schlicht vertrauen muss.
Dieses Vertrauen ist an vielen Stellen angeknackst.
Ich glaube nicht, dass viele deutsche Journalisten in irgendeinem engeren oder weiteren Sinne gekauft sind. Ich glaube aber, dass sie nicht unvoreingenommen sind. Dass die Berichterstattung tatsächlich, vermutlich oft unterschwellig und unbewusst, geprägt ist von einer klaren Überzeugung, dass es hier eine gute Seite und eine böse Seite gibt. Dass man den Aussagen der einen Seite prinzipiell glauben kann, bis das Gegenteil erwiesen ist, und den Aussagen der anderen Seite prinzipiell nicht glauben kann, bis das Gegenteil erwiesen ist.
So ließen sich auch die vielen, oft kleinen Fehler erklären, die in der Berichterstattung zuungunsten der russischen Seite zu passieren scheinen. (Die Seite der Kritiker erliegt natürlich demselben Phänomen und interpretiert die Berichterstattung ausschließlich vor der Schablone, dass sie vermutlich falsch, gesteuert und anti-russisch ist und hat eine entsprechend gefärbte Wahrnehmung, die zu Fehlurteilen führt. Viele Anti-Mainstream-Medien-Blogs sind insofern mindestens so voreingenommen.)
Um ein vergleichsweise läppisches Beispiel zu nehmen: Im Frühjahr, als die umstrittene Abstimmung auf der Krim über den Anschluss an Russland stattfand, sahen die deutschen Medien, dass dort durchsichtige Wahlurnen verwendet wurden, und nahmen das als weiteres Indiz dafür, dass es kein Wahlgeheimnis gab und die Wahl also eine Farce sei. Tatsache ist, dass in der Ukraine solche durchsichtigen Wahlurnen Tradition haben. Tatsache ist sogar, dass die OSZE den Einsatz solcher Urnen als vertrauensbildende Maßnahme aktiv unterstützt.
Aber weil die Organisatoren des Referendums böse waren, war klar, dass auch hinter dem Einsatz der für uns ungewöhnlichen Kisten eine böse Absicht stecken musste. Dafür ist gar keine Absprache, keine Verabredung, kein „Kauf“ der Journalisten nötig, nur eine entsprechende Voreingenommenheit, die den Blick auf alles, was passiert, entsprechend prägt — und trübt.
Ich habe bewusst ein kleines Beispiel gewählt, weil es in größeren Zusammenhängen natürlich schnell unübersichtlich und komplex wird; zum Beispiel etwa, wenn es darum geht, welche Vorgänge verfassungswidrig sind. Die Abspaltung der Krim von der Ukraine? Die Absetzung Wiktor Janukowitschs als Präsident?
Mein subjektiver (und natürlich zu pauschaler) Eindruck ist, dass die Berichterstattung über die Vorgänge in der Ukraine von solcher Voreingenommenheit geprägt ist. Dass die etablierten deutschen Medien sich erstaunlich wenig mit den zweifelhaften Umständen der Revolution beschäftigt haben — Bröckers und Schreyer liefern Beispiele dafür.
Gerade das wäre aber nötig. Gerade in einem Konflikt, der so gefährlich ist und uns so sehr betrifft. Viele Medien wirken, als betrachteten sie sich als Teil der Auseinandersetzung; sie kämpfen mit und für „den Westen“ gegen Russland und seinen irren, gefährlichen, skrupellosen Präsidenten. Es ist nicht nur Gut gegen Böse, sondern sogar Wir Guten gegen Die Bösen.
Bröckers und Schreyer schreiben:
Ob sie es selbst nun merkten oder nicht, viele Journalisten hatten im Frühjahr 2014 bereits in den Kriegsmodus geschaltet, dessen Logik vor allem besagte: Traue niemals dem Feind. (…)
Im Ergebnis dient das Vehikel der „russischen Propaganda“, ebenso wie der in anderen Zusammenhängen häufig verwendete Begriff „Verschwörungstheorie“, einer pauschalen Abwertung und Ausgrenzung jeglicher missliebigen Information. Da die vorgeblichen Fakten ja vom Feind stammen und der Feind bekanntlich gerne lügt, ist eine weitere Diskussion von Einzelheiten überflüssig. Ende der Debatte also. Wir sind doch nicht blöd und glauben am Ende noch den Russen — so der mehr oder weniger unterschwellige Tenor.
Es geht dabei nicht darum, der russischen Propaganda blauäugig gegenüberzutreten. Es geht darum, zu erkennen, dass dem russischen Propagandafeldzug nicht auf der anderen Seite Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit gegenübersteht; dass auch „der Westen“, die Nato, die „westlich orientierte“ Regierung der Ukraine diesen Kampf um die Meinungshoheit mit allen Mitteln führt. Und zu erkennen, dass es die Aufgabe freiheitlicher Medien ist, gerade auch diese vermeintlich eigene und vermeintlich gute Seite besonders kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Ich vermisse dieses Bewusstsein in der Berichterstattung.
Die WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich schreibt im „Medium Magazin“:
Trotzdem gewinne ich dem Rauschen aus dem Netz einiges ab, denn er schärft mein Selbstverständnis als Journalistin. Von Zeit zu Zeit muss das sein! Erst beim Irak-Krieg stellten wir die Grundsatzfrage, ob wir „embedded“ arbeiten dürfen. (Als ob Kriegsreporter zuvor nicht auch mit einer der Parteien „reingingen“.) Erst als CNN beim Bombardement von Bagdad News in Real Time lieferten, beschäftigten wir uns mit den Folgen der beschleunigten Übertragungswege. Und ja, erst bei dieser neuen Eiszeit zwischen Ost und West verdrängen wir nicht mehr, dass unsere Arbeit Propagandastrategien direkt und indirekt beeinflusst. Wir sind Kriegsteilnehmer, ob wir es wollen oder nicht.
Das stimmt, und doch ist der vorletzte Satz erstaunlich umständlich formuliert. Die Arbeit von Journalisten beeinflusst nicht nur Propagandastrategien, sie ist auch von Propagandastrategien beeinflusst — und Journalisten scheinen da erstaunlich wenig Widerstand oder Selbst-Bewusstsein zu entwickeln.
Bei einer Diskussion bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises Ende Oktober an Golineh Atai sagte Mikich:
Wir erleben hier einen qualitativen Sprung sondergleichen, mit dem Internet als Echo-Raum. Wo alles, was wir sagen, zehnfach zurückkommt. Verzerrt, gehässig, manchmal kritisch und gut, aber auf jeden Fall schwierig, Arbeit machend und so weiter. (…) Wir machen Nachrichten, Berichte in einer Empörungsdemokratie, die da im Internet unendlich stark auf uns einwirkt, und zwar so einwirkt, dass man sich verkrampft. (…) Wir verkrampfen uns. (…) Ich verkrampfe mich. Wenn ich jetzt überlege, Golineh will einen Bericht machen, meinetwegen über junge russische Demokraten: Macht sie das, um einer Öffentlichkeit, um dieser Internetgemeinde zu sagen, wir sind ja gar nicht so, wir sehen das auch? Oder macht sie das, weil sie journalistische Neugier hat. Diese Verkrampfung halte ich wirklich für einen ganz großen Schaden, und der ist dem Internet vor allem geschuldet.
Ich verstehe, was sie meint, und natürlich dürfen sich Journalisten nicht einschüchtern lassen, nicht von einem oft maßlos formulierenden und unfassbar aggressiv agierenden Mob, und schon gar nicht von persönlichen Drohungen, denen sich Korrespondenten wie Atai offenbar ausgesetzt sehen.
Andererseits höre ich Sätze wie „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen“, wie sie „Spiegel“-Autor Christian Neef formulierte, mit einem Unbehagen. Weil das auch ein bequemes Abtun der Kritik bedeuten kann.
Gerade angesichts der vielfältigen Kritik müsste es doch ein viel stärkeres Problembewusstsein geben in den Redaktionen. Stattdessen passieren absurde Pannen wie der gleich mehrfache grob irreführende Einsatz von alten Fotos zur Illustration aktueller Vorgänge im WDR. Man sollte doch denken, dass Journalisten inzwischen so sensibilisiert sind — sensibilisiert, nicht verkrampft — dass sie den Einsatz jedes Symbolfotos zu diesem Konflikt doppelt hinterfragen. Wie viele „reine Unaufmerksamkeiten“ können denn passieren? Ja, Fehler passieren immer und überall und lassen sich nicht vermeiden, aber kann man vom Qualitätsjournalismus wirklich nicht verlangen, unbestätigte Meldungen über angebliche russische Truppenbewegungen in der Ukraine nicht mit Fotos von russischen Truppenbewegungen in Russland zu bebildern, wie es die „Frankfurter Rundschau“ gerade wieder gemacht hat?
Und wie ist es zu erklären, dass ARD-Korrespondent Udo Lielischkies, der von den Kritikern besonders massiv angegangen wird, nach der Parlamentswahl in der Ukraine in der 20-Uhr-„Tagesschau“ zur Legitimation dieser Abstimmung sagte: „Mit einer Wahlbeteiligung von gut 52 Prozent immerhin höher als der Durchschnitt der letzten drei Parlamentswahlen“ — wenn es mit Abstand die niedrigste Wahlbeteiligung war?
(Soviel zum Thema „weiterhin journalistisch präzise arbeiten“, Herr Grätz.)
ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat bei der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis-Diskussion gesagt, das ZDF habe eine Art internen Qualitätszirkel eingerichtet und die eigene Berichterstattung kritisch reflektiert.
Natürlich müssen wir das beachten, was uns da entgegenschlägt. Es darf uns aber nicht im Mark verunsichern. Denn: Die Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendungen hat nicht Schaden gelitten. Das Interesse der Zuschauer ist doch groß. Einen Glaubwürdigkeitsverlust der großen Plattformen, „Tagesschau“, „heute“, „heute-journal“, „Tagesthemen“, kann ich nicht erkennen. (…) In dieser Situation ist es gar nicht möglich, keinen Fehler zu machen. Aber am Ende seien wir doch selbstbewusst, dass unsere Redakteure und Korrespondenten, jedenfalls zu 98 Prozent hier, einen Prima-Job gemacht haben.
Es gab Applaus an dieser Stelle.
Ich bin nicht so überzeugt. Ich glaube, dass wir von unseren Qualitätsmedien erwarten können, dass sie genauer berichten. Dass sie weniger Fehler machen, vor allem, wenn es um Krieg und Frieden geht. Dass sie sensibilisiert sind für eine mögliche eigene Voreingenommenheit, was die Berichterstattung kleiner Details angeht, aber auch das große Ganze. Dass sie in einem viel größeren Maße ihre Rolle reflektieren, die Position, die sie einnehmen. Dass sie bewusst die Perspektiven wechseln und sich nicht als Kriegs- oder Konfliktpartei verstehen. Und dass sie sich kritisch und selbstkritisch mit Vorwürfen, wie sie zum Beispiel Bröckers und Schreyer erheben, auseinandersetzen — all das, was die staatlich gelenkten russischen Propagandamedien nie tun würden.

 Die Art von großer Recherche also, die sich kaum noch jemand leisten kann. Qualitätsjournalismus.
Die Art von großer Recherche also, die sich kaum noch jemand leisten kann. Qualitätsjournalismus. PS: Die Konkurrenz von der „Bunten“ fand schon ein Fragezeichen hinter ihrer Schlagzeile zuviel der Seriosität. Da weiß man wenigstens, was man hat. Und vor allem: was nicht.
PS: Die Konkurrenz von der „Bunten“ fand schon ein Fragezeichen hinter ihrer Schlagzeile zuviel der Seriosität. Da weiß man wenigstens, was man hat. Und vor allem: was nicht.