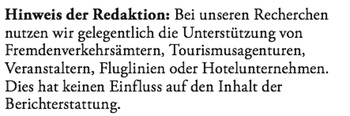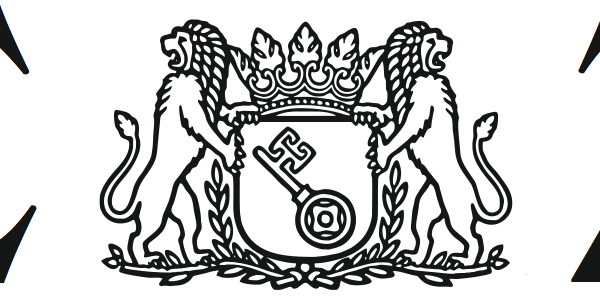
„Die Zeit“ und „Zeit Online“ haben sich auf gemeinsame ethische Richtlinien für ihre Arbeit verständigt. Bislang hatten die Zeitung und ihr Internet-Angebot getrennte und teils voneinander abweichende Regelwerke (nämlich dieses und dieses).
Wegen der Abstimmung mit diversen Gremien und Stellen in Redaktion und Verlag zog sich der Fusionsprozess über viele Monate hin. Nun soll er aber auf entsprechend breitem Fundament stehen.
An einer Stelle gleich im ersten Absatz ist der neue Kodex gegenüber seinen Vorgängern entschärft: In der Aufzählung, welche möglichen Interessenkonflikte Redakteure gegenüber ihren Vorgesetzten offenlegen müssen, fehlt die Mitgliedschaft in Organisationen. Der stellvertretende „Zeit“-Chefredakteur Moritz Müller-Wirth sagt: „Wir haben hart darum gerungen, aber da haben sich unsere Juristen durchgesetzt. Sie haben uns darauf hingewiesen, dass wir als Arbeitgeber auf Grund höchstrichterlichen Entscheidungen kein generelles Recht haben, unsere Mitarbeiter nach solchen Mitgliedschaften zu fragen.“
Die bislang nur für Online explizit formulierte Vorgabe, dass „Reisen im Rahmen journalistischer Berichterstattung selbst bezahlt“ werden, gilt nun auch für die Print-Redaktion. Eine Ausnahme gibt es für das Reiseressort der gedruckten „Zeit“, das „bei einzelnen Recherchen die Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen, Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen in Anspruch“ nehmen darf, worauf ein Kasten im „Reisen“-Teil hinweist.
Vorgaben, die sich dem Verhältnis zu den Anzeigenkunden widmen, hatte es vorher nur für „Zeit Online“ gegeben. Bei der „Zeit“ war man anscheinend davon ausgegangen, dass sich die Leser ohnehin nicht vorstellen könnten, dass sich ihre Wochenzeitung von Werbekunden reinreden lassen würde. Nun ja. Jedenfalls gelten diese Regeln von nun an gleichermaßen für Print und Online.
Der vorher in der Online-Version geltende Satz, dass eine Benennung als „Spezial“, „Verlagsbeilage“ oder „Sonderveröffentlichung“ nicht vorkommen dürfe, ist zwar weggefallen. Aber dafür gibt es eine eindeutige Kennzeichnungspflicht. „Es ist ganz einfach“, sagt Müller-Wirth. „Generell muss überall ‚Anzeige‘ drüberstehen. Ausnahmen sind sich selbst erklärende Angebote aus unserem eigenen ‚Zeit‘-Shop und weitere Serviceleistungen des Verlages, die als ‚Verlagsangebote‘ gekennzeichnet werden.“
Der unterschiedliche Grad an redaktioneller Kontrolle bleibt erhalten: Online-Texte werden von mindestens einer, Print-Texte von mindestens zwei weiteren Personen auf „sachliche und stilistische Qualität überprüft“.
Die neuen Regeln wurden jetzt ins Intranet gestellt. Veröffentlichen oder selbst den Lesern bekanntmachen will die „Zeit“ ihre neuen Regeln rätselhafterweise nicht, sondern nur im Einzelfall bei Nachfragen Auskunft geben. Vielleicht findet man es im Haus einfach eleganter, wenn jemand anders das Werk publiziert.
Also gut.
Code of Ethics von ZEIT ONLINE und DIE ZEIT
1. JOURNALISTISCHE UNABHÄNGIGKEIT
a. Redakteure von ZEIT ONLINE und ZEIT legen mögliche Interessenkonflikte gegenüber ihrem direkten Vorgesetzten offen. Ein möglicher Interessenkonflikt liegt vor, wenn durch Bekleiden eines Amtes oder durch ein Mandat in Vereinen, Parteien, Verbänden und sonstigen Institutionen einschließlich Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, durch Beteiligung an Unternehmen, durch Nebentätigkeit oder durch Beziehungen zu Personen oder Institutionen der Anschein entstehen kann, dass dadurch die Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit/Objektivität der Berichterstattung über diese Vereine, Parteien, Verbände, Unternehmen, Personen und sonstigen Institutionen beeinträchtigt werden könnten. Der direkte Vorgesetzte entscheidet, ob der Auftrag aufrechterhalten wird, und ggf., ob der Umstand, der den möglichen Interessenkonflikt begründet, mit Zustimmung des Redakteurs in dem Artikel offengelegt wird.
b. Aktienbesitz wird innerhalb der Wirtschaftsressorts offen gelegt.
c. Die Redaktionen von ZEIT ONLINE und ZEIT nehmen keine Journalistenrabatte in Anspruch. Auch von der privaten, außerdienstlichen Nutzung von Journalistenrabatten wird abgeraten. Insbesondere ist es nicht gestattet, bei privater Beantragung von Journalistenrabatten auf ZEIT ONLINE oder ZEIT als Arbeitgeber zu verweisen.
d. Reisen im Rahmen journalistischer Berichterstattung werden selbst bezahlt. Bei Einladungen wird eine den Reisekosten entsprechende Summe gegen Rechnung überwiesen. Begleiten Journalisten Politiker, Manager oder andere auf Reisen im In- und Ausland, wird in der Regel von den Ausrichtern die übernahme der Kosten angeboten. Solche Kostenübernahme-Angebote lehnen ZEIT ONLINE und ZEIT ab.
Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen Reisen in Krisengebiete oder Reisen mit Politikern bzw. an Bord von Flugzeugen oder Schiffen der deutschen Bundeswehr, wenn über Themen von erheblichem öffentlichen Interesse berichtet wird und diese Berichterstattung aus eigenen Mitteln oder aus Gründen der persönlichen Sicherheit des jeweiligen Reporters nicht realisierbar wäre.
Ausnahmen sind auch ergebnisoffene Reisestipendien von Organisationen wie IJP oder der Arthur F. Burns Fellowship. Auch wenn Redakteure von einer externen Organisation zu einer Reise eingeladen werden und sämtliche Reisekosten von der Redaktion selbst getragen werden, sollte in den mithilfe dieser Reise entstanden Beiträgen dennoch darauf hingewiesen bzw. erwähnt werden, wer diese Reise organisiert hat.
Das ZEIT-Ressort „Reisen“ nimmt bei einzelnen Recherchen die Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen, Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen in Anspruch. Dies wird im „Reisen“-Teil der ZEIT durch einen entsprechenden Vermerk transparent gemacht.
Ausnahmen von diesen Regelungen müssen von der Chefredaktion genehmigt werden.
e. Alle Arten von Geschenken werden sozialisiert, soweit sie einen Wert von 40 Euro überschreiten. Redakteure liefern Geschenke an einer zentralen Stelle ab. Am Ende des Jahres werden sie zugunsten eines wohltätigen Zwecks versteigert.
f. Bücher oder andere Produkte von Redakteuren werden nicht redaktionell bewertet. Bei eventuellen Vorabveröffentlichungen solcher Werke wird die Befangenheit für den Leser deutlich gekennzeichnet.
Redakteure können ihre Bücher auf ihren persönlichen ZEIT-Online-Profilseiten erwähnen. Diese Erwähnungen können auf begleitende Websites dieser jeweiligen Bücher oder Leseproben der jeweiligen Verlags-Site verlinkt werden. Bei der Besprechung von Büchern ehemaliger Redakteure von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT wird auf den Umstand ihrer früheren Redaktionszugehörigkeit hingewiesen.
g. Jede Nebentätigkeit von Redakteuren muss der jeweiligen Chefredaktion angezeigt werden. Die Nebentätigkeit kann nur untersagt werden, wenn berechtigte Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen, etwa mögliche Beeinflussung der Berichterstattung, mögliche Beschädigung der Marke ZEIT / ONLINE oder Tätigkeit für ein Konkurrenzunternehmen. Der Chefredakteur muss seine Nebentätigkeiten dem Verleger anzeigen. Die Regelung in den Arbeitsverträgen bleibt hiervon unberührt.
h. Freie Mitarbeiter müssen Tätigkeiten in dem Journalismus nahen Bereichen – Marketing, PR – offen legen. Eine Tätigkeit in einem dieser Bereiche schließt in der Regel die redaktionelle Bearbeitung inhaltlich verwandter Themen bei ZEIT ONLINE und ZEIT für den Zeitraum eines Jahres nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit in Marketing und PR aus, wenn nicht in beiderseitigem Einvernehmen eine Regelung getroffen werden konnte, die eine Einflussnahme auf die Berichterstattung ausschließt.
2. QUALITÄTSSICHERUNG
a. Jeder auf ZEIT ONLINE erscheinende Text wird außer vom Autor noch von mindestens einer weiteren Person, jeder in der ZEIT erscheinende Text von mindestens zwei weiteren Personen auf sachliche und stilistische Qualität überprüft und anschließend von einem Korrektor auf Orthografie, Interpunktion und Grammatik. An der Verantwortung für die Richtigkeit der redaktionellen Inhalte, die durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist, ändert sich durch diese Regelung nichts.
b. Bei berechtigter Kritik durch Leser an einem Online-Text melden sich Online-Redakteure und je nach Möglichkeit auch Print-Redakteure, die online publiziert haben, im Kommentar-Thread unter ihrem Artikel selbst zu Wort.
Faktische Fehler werden dabei in folgender Weise berichtigt:
1. Korrektur der betreffenden Textstelle
2. ein Hinweis unter dem Text, dass korrigiert wurde
3. sofern geboten: im Kommentarthread eine Antwort an den jeweiligen Leser, die seinen Hinweis anerkennt
Inhaltliche Fehler online nur stillschweigend auszubessern ist nicht akzeptabel.
Werden in Print-Artikeln Fakten (insbesondere zur Stützung eigener Argumente) wiedergegeben, die sich im Nachhinein als falsch erweisen, ist dies, nach Möglichkeit vom Autor selbst, im Blatt zu korrigieren. Ist der Print-Artikel auch online zu finden, wird dort auf die jeweilige Korrektur verwiesen.
3. BEZIEHUNG ZU ANZEIGENKUNDEN
a. Anzeigenkunden haben keine Möglichkeit, den redaktionellen Inhalt zu beeinflussen. Einzelne Themen tauchen zwar durchaus auch aufgrund möglicher Anzeigenerlöse in ihrem jeweiligen Umfeld auf, potenzielle Inserenten haben jedoch keine Möglichkeit, auf Umfang, Art und Urteil der Berichterstattung Einfluss zu nehmen.
b. Kein Anzeigenkunde kann durch die Drohung, Aufträge zu stornieren, kritische Berichterstattung verhindern.
c. Anzeigen müssen sich in der Darstellung vom Layout der redaktionellen Inhalte von ZEIT ONLINE bzw. ZEIT offensichtlich unterscheiden. Dies betrifft zum Beispiel Schrifttype, Spaltenbreite, Link- oder Hintergrundfarbe. Advertorials müssen stringent als „Anzeige“ gekennzeichnet sein. Verweise auf Online-Angebote des ZEIT-Verlags (Stellenmarkt, ZEIT-Shop, etc.) werden mit dem Zusatz „Verlagsangebot“ gekennzeichnet.
d. Die Details der auf ZEIT ONLINE einzusetzenden Werbemittel sind in der zwischen Chefredaktion und Verlagsgeschäftsführung regelmäßig definierten Werbemittelkonvention geregelt.
4. VERHÄLTNIS ZU KOMMERZIELLEN PRODUKTEN IM EIGENEN HAUS
a. Kommerzielle Produkte des Verlages werden im redaktionellen Teil nicht besprochen. Ausnahmen bilden Non-Profit-Produkte des Verlages.
b. Veranstaltungen, die der Verlag ausrichtet, werden in aller Regel im redaktionellen Teil nicht besprochen. Wertende Berichterstattung dazu findet grundsätzlich nicht statt. Eine dokumentierende Wiedergabe als Video oder im Wortlaut ist möglich und liegt im Ermessen der Redaktion.
c. Geschäftspartner, die Veranstaltungen, Produkte oder andere Aktivitäten des Verlages unterstützen, haben keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung.
d. Für journalistische Produkte im Bereich von Corporate Publishing des ZEIT Verlags (Tempus Corporate GmbH) dürfen Redakteure und feste freie Mitarbeiter nicht aktiv werden. Freie Mitarbeiter müssen ihre Mitarbeit im Corporate Publishing offen legen – und sind daraufhin im entsprechenden Themenbereich als Autoren für ein Jahr nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit im Corporate Publishing gesperrt.
5. DER CODE OF ETHICS IST EINE FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG
Etwaige Verstöße dagegen ziehen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen nach sich. Davon ausgenommen sind Verstöße gegen Pflichten, die sich bereits aus dem Arbeitsverhältnis der jeweiligen Kollegin/des jeweiligen Kollegen ergeben.