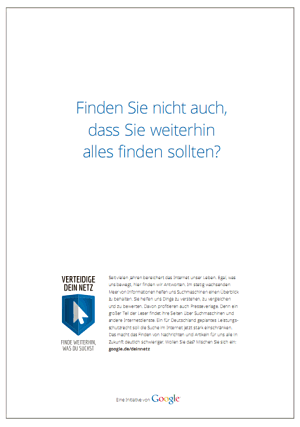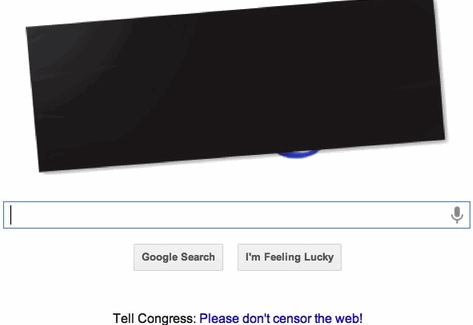Die deutsche Presse setzt ihre Desinformations- und Diffamierungskampagne fort. Im publizistischen Kampf für ihr eigenes Leistungsschutzrecht setzt heute Reinhard Müller auf der Titelseite der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen drauf drunter.
Zunächst überrascht er mit der Feststellung, dass Google „kein internationaler Wohlfahrtsverband“ sei, „sondern auch mächtiger Arm der amerikanischen Regierung“. Das war mir tatsächlich neu.
Dann erwähnt Müller immerhin, dass es noch andere Kritiker an dem Gesetzesvorhaben gibt:
Aber sind nicht auch die Jugendorganisationen aller Parteien dagegen? Erklärt uns nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Verlage müssten eben mehr investieren? Weisen nicht Professoren auf das angeblich überholte „Geschäftsmodell Zeitung“ hin? Gewiss: Wer sein Geld nicht selbst verdienen muss oder vom Staat bezahlt wird (also von allen Steuerzahlern unabhängig von seiner Leistung getragen wird), der kann leicht den Marktliberalen spielen. Es kostet ja nichts.
Das ist ja praktisch. Die FAZ muss sich nicht inhaltlich mit der Kritik auseinandersetzen, weil sie eh nur von Schnorrern und Soziale-Hängematten-Bewohnern kommt. Weil in den Jugendorganisationen von CDU/CSU, FDP, SPD, Grünen und Piraten, die gemeinsam vor dem Leistungsschutzrecht warnen, auch Schülerinnen und Schüler sind, die möglicherweise noch keine Zeitung austragen, kann man ihre Äußerungen getrost ignorieren. Und Professoren sollen erst mal schön in der privaten Wirtschaft ihr Geld verdienen, ehe sie uns mit ihrem Expertentum belästigen.
Die FAZ hat — ebenso wie die „Süddeutsche Zeitung“ — ihre Leser bis heute nicht darüber informiert, dass es eine gemeinsame Erklärung namhafter Urheber- und Medienrechtler gibt, in der sie vor „unabsehbaren negativen Folgen für die Volkswirtschaft und die Informationsfreiheit in Deutschland“ warnen, wenn das Leistungsschutzrecht kommt. In dieser Erklärung ist übrigens in keiner Weise von einem angeblich überholten „Geschäftsmodell Zeitung“ die Rede.
Die FAZ verschweigt ihren Lesern relevante Kritik und diffamiert pauschal die Kritiker. Ausgerechnet die FAZ, die bei diesem Thema seit Jahren beweist, dass sie zu einer unabhängigen, ausgewogenen, fairen Berichterstattung nicht willens oder fähig ist, spricht den Professoren ab, vernünftig urteilen zu können, weil sie ja vom Staat bezahlt werden.
Reinhard Müller verantwortet bei der FAZ die Seite „Staat und Recht“, auf der vor drei Jahren Jan Hegemann, ein bezahlter Interessensvertreter von Axel Springer, als scheinbar unabhängiger Experte für das Leistungsschutzrecht werben durfte. An gleicher Stelle erschien in diesem Jahr erneut versteckte Eigenpropaganda: ein weiterer Gastkommentar pro Leistungsschutzrecht von einem vermeintlich unabhängigen Experten, der in Wahrheit ein Verlagsvertreter ist.
Laut Reinhard Müller diskreditiert es Teilnehmer an der Debatte, wenn sie möglicherweise vom Staat (oder von ihren Eltern) bezahlt werden. Es diskreditiert sie nicht, wenn sie von den Verlagen bezahlt werden.
Frederic Schneider hat vor drei Tagen sein FAZ-Abo gekündigt, weil deren einseitige Berichterstattung über Google und das Leistungsschutzrecht „der journalistischen Institution FAZ nicht würdig“ sei. Aber Schneider ist ja bloß Kreisvorsitzender der Jungen Union Main-Taunus. Auf solche Leute, die womöglich nicht einmal ihr eigenes Geld verdienen, können die FAZ und Reinhard Müller gut verzichten.