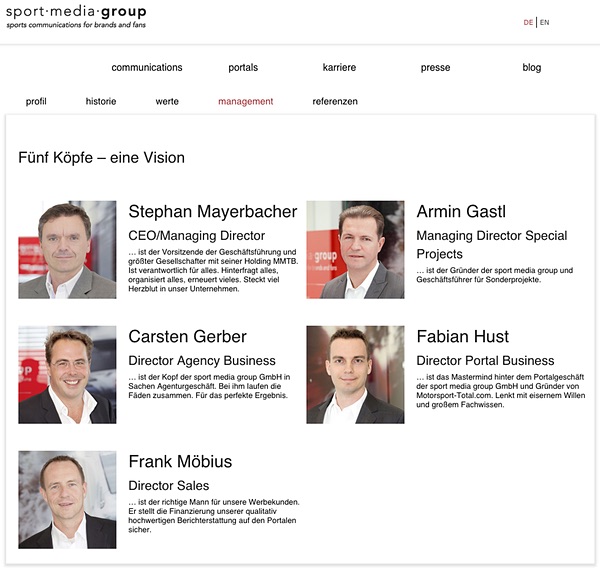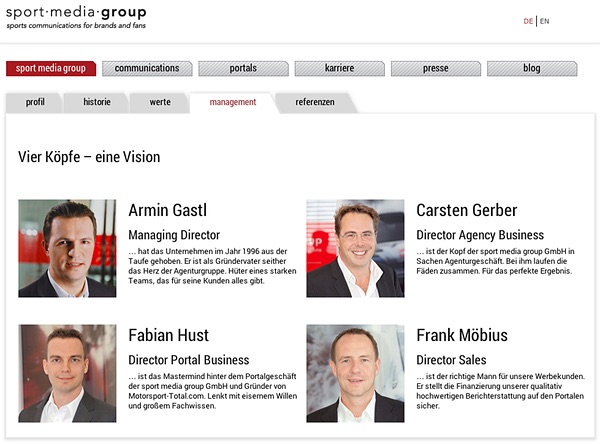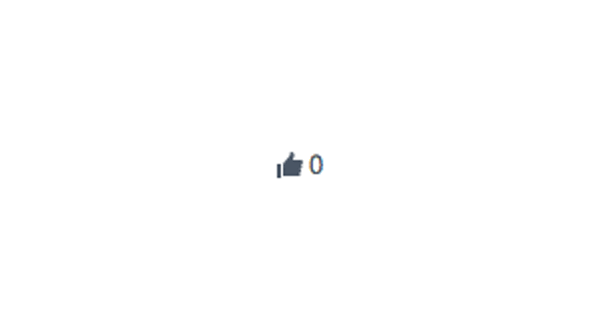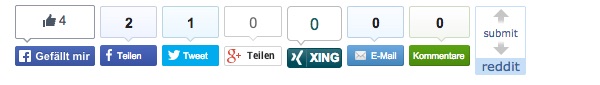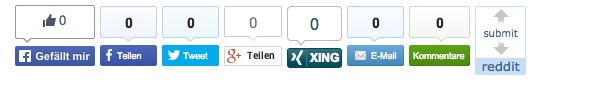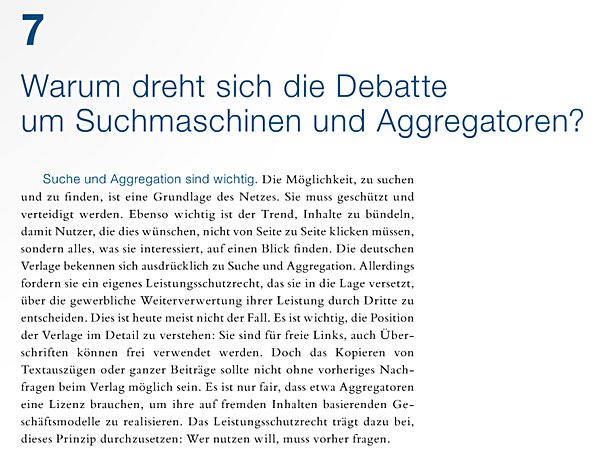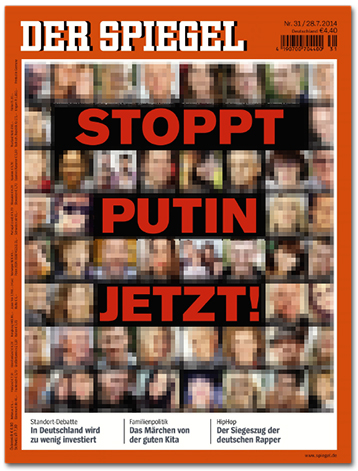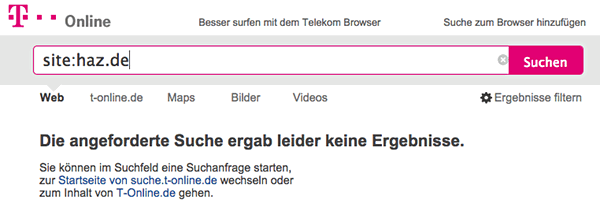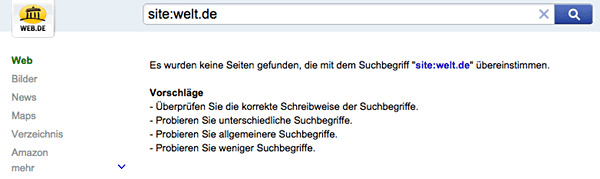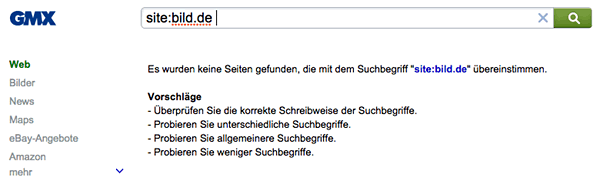Bei der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf haben sie kürzlich zum Telefon gegriffen und in den Achtzigerjahren angerufen, um sich ein Logo für eine Werbekampagne zu bestellen. Die Achtzigerjahre haben gesagt: Cool, da haben wir hier noch was rumliegen, so eine flott hingezeichnete Zeitung, aufgeklappt, und oben, voll dufte, wächst eine stilisierte Stadt heraus. Drunter schreiben wir den Slogan, okay? Und das Ganze in Ortsschildgelb. – Das haben die Achtzigerjahre dann geliefert:

Nun, 2014, wirbt die „Rheinische Post“ mit diesem Logo – für Lokalzeitungen, so gedruckte, auf Papier. Und mit ihr werben noch einige andere Verlage in Nordrhein-Westfalen, sieben insgesamt; außerdem sind die Grossisten eingespannt. Vorigen Samstag haben sie 9.000 Einzelhändlern in NRW Werbeträger geliefert: „Große Deckenhänger, Aufkleber, Regal-Wobbler und Luftballons mit dem gemeinsamen Aktionstitel“. Regal-Wobbler, das sind so Schilder, die man, nun ja: an Regale klemmen kann, und zusammen mit dem anderen Kram sollen sie „bei Kunden Aufmerksamkeit wecken und den Verkauf der lokalen Tageszeitungen steigern“.
Und davon träumen die Verleger nicht nur nachts.
Sie träumen davon, dass eine Familie in einen Laden kommt, dieses Logo sieht und die Eltern dann sagen: Och, stimmt, so eine Lokalzeitung. Lange nicht gelesen. Lange nichts von gehört. Kaufen wir noch mal. Und der Verkäufer reicht dem Kind einen Luftballon herunter. Das Kind freut sich dann auf die Zeit, irgendwann, in der es endlich Lokalzeitung lesen kann. Und anschließend gehen alle zu Hertie.
Statt mit relevanten Recherchen und guten Geschichten auf die Lokalzeitung aufmerksam zu machen, pusten die Verlage Luftballons auf. Wie früher. Man wolle die „Vorzüge der Lokalzeitung in Erinnerung rufen“, steht in der Pressemitteilung. Mit „Vorzügen“ sind wohl die Schlagworte „lokal“, „nah“ und „kompetent“ in der Unterzeile der Kampagne gemeint. Und das ist der Witz: Die Verleger in NRW wollen an etwas erinnern, das sie seit Jahren dem Vergessen preisgeben.
Einer der werbenden Verlage ist die Essener Funke-Gruppe. Sie gibt die WAZ heraus, die größte Regionalzeitung Deutschlands, einst mit etlichen Lokalredaktionen im Ruhrgebiet. Daneben gehört der Funke-Gruppe die „Neue Ruhr- bzw. Rhein-Zeitung“ (NRZ), die sich bis ins Rheinland erstreckt; die „Westfälische Rundschau“ (WR) im Revier und in Südwestfalen; und die „Westfalenpost“ (WP) im Sieger- und Sauerland, alle ebenfalls mit Lokalredaktionen. Doch seit Jahren ziehen sich diese Zeitungen zurück. Die WAZ etwa hatte unter anderem mal Lokalredaktionen in:
Castrop-Rauxel
Datteln
Dorsten
Haltern am See
Herten
Marl
Oer-Erkenschwick
Waltrop
Die sind jetzt alle weg. Die Lokalteile im Bezirk Vest wurden zunächst, ab 2006, noch in Recklinghausen gemacht, von einer Redaktion, die personell überschaubar ausgestattet war: dem „Regionalen Content-Desk“. So nannte die Funke-Gruppe das damals (noch als WAZ-Gruppe) und feierte es als zukunftsweisendes Modell für guten lokalen und regionalen Journalismus. Doch 2013 war die Zukunft dann schon wieder vorbei. Auch die Recklinghäuser Desk-Redaktion wurde geschlossen.
Eine andere Methode: Inhalte der Konkurrenz übernehmen und ins eigene Layout wurschteln. Das ist nicht nur in NRW zur Mode geworden. Doch die Funke-Gruppe hat bei der „Westfälischen Rundschau“ (WR) auf eindrückliche Weise demonstriert, wie das geht: Voriges Jahr entließ sie alle Redakteure der WR, stellte die Zeitung aber nicht ein. Den Mantel liefert nun die WAZ, die Lokalteile die (konservative) Schwesterzeitung „Westfalenpost“ oder die örtliche Konkurrenz. In Dortmund zum Beispiel füllen die „Ruhr Nachrichten“ den Lokalteil, was früher, unter den alten Verlegervätern, undenkbar gewesen wäre: Dass in der sozialdemokratischen WR mit roter Schmuckfarbe mal Texte aus den konservativ-blauen RN stehen.
Die WR hatte unter anderem mal Lokalredaktionen in:
Altena, Arnsberg, Bad Berleburg, Bergkamen, Betzdorf, Dortmund, Ennepe-Süd, Hagen, Halver, Holzwickede, Iserlohn, Kamen, Kierspe, Lüdenscheid, Lünen, Meinerzhagen, Olpe, Plettenberg, Siegen, Schwerte, Unna, Warstein, Werdohl, Wetter-Herdecke.
Auch alle weg. Und inzwischen ist fraglich, wie lange es die WR als Geisterzeitung ohne Redaktion überhaupt noch geben wird. Die Funke-Gruppe hat kürzlich einen Insolvenzverwalter beauftragt, die Zukunft der Zeitung auszubaldowern.
Wenn Lokalredaktionen schließen, hat das auch zur Folge, dass immer mehr Einzeitungskreise entstehen. Der Zeitungsforscher Horst Röper schreibt dazu:
Inzwischen haben rund 45 Prozent der nordrhein-westfälischen Bevölkerung keine Auswahl mehr, wenn sie sich über das lokale Geschehen am Wohnort informieren wollen. Sie leben diesbezüglich in Monopolgebieten. Zwar werden vielerorts noch zwei unterschiedliche Titel angeboten, aber beide mit identischer Lokalberichterstattung.
Deshalb glaube ich ja auch, dass sich die Verleger bloß verschrieben haben. Und eigentlich das hier auf die Luftballons drucken wollten:

Und es ist ja nicht nur die Funke-Gruppe, die ausdünnt in NRW:
Die Kölner Zeitungsverlage Heinen und DuMont Schauberg, auch an der Kampagne beteiligt, haben dieses Jahr Lokalredaktionen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ und der „Kölnischen Rundschau“ zusammen gelegt.
Der Dortmunder Verleger Lensing-Wolff (interessanterweise bei der Kampagne nicht mit von der Partie) hat kürzlich angekündigt, die Bochumer und Wittener Lokalredaktionen der „Ruhr Nachrichten“ zu schließen. 2006 hatte sich Lensing bereits aus Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck zurückgezogen.
Im Jahr 2006 verschwand auch die letzte Stadtteilzeitung in Nordrhein-Westfalen: die „Buersche Zeitung“ in Gelsenkirchen. Das Marler Medienhaus Bauer beerdigte sie kurz vor ihrem 125-jährigen Bestehen. Und der Verleger Dirk Ippen stellte die „Mendener Zeitung“ im Jahr 2010 zum 150. Geburtstag ein.
Okay, kurzer Einwand: Die Fakten sprechen natürlich eher gegen Lokalzeitungen. Tageszeitungen insgesamt verlieren bekanntlich seit Jahren an Auflage. 2004 wurden noch so um die 26 Millionen Exemplare gedruckt, deutschlandweit. Heute sind es um die 20 Millionen. Und auch die Werbeerlöse sind weiterhin mies.
Dass die Verlage umdenken, hat also durchaus rationale Gründe. Ob aber ein Rückzug aus dem Lokalen das probate, zukunftsweisende Mittel für Lokalzeitungen ist, kann man ja zumindest mal anzweifeln. Außer man ist Verleger, macht eine Kampagne und weiß auch den Rückzug noch als Angriff zu verklären, worin vor allem Funke-Geschäftsführer sehr geübt sind.
Die Funke-Gruppe hat in den vergangenen Jahren ihre Wurzeln im Lokalen derart rabiat gekappt, dass man sich im Ruhrgebiet vor der „WAZ-Axt“ fürchtet, die immer mal wieder zuschlägt: Hunderte Redakteurs-Stellen wurden abgebaut, Redaktionen geschlossen, zusammengelegt oder outgesourct. Die Leser erfahren davon wenig bis gar nichts, weil die Zeitungen selten über sich selbst berichten.
Und wenn, dann verkaufen die Verleger Kooperationen und Schließungen noch als Erhalt der Pressevielfalt. Oder sie hoffen, dass es lautlos über die Bühne geht. Der ehemalige Funke-Geschäftsführer Christian Nienhaus sagte 2013 einen tollen Satz, als er verkündete, die „Westfälische Rundschau“ werde ohne Redaktion erstellt. Er sagte: „Wir hoffen, dass die Abonnenten davon möglichst wenig merken.“

Diese Leser sollen nun aber eine inhaltslose Kampagne mit ollem Logo bemerken und daraufhin Lokalzeitungen kaufen. Das ist doch bemerkenswert.
Nachtrag, 3.10.2014. Ich war mal in Nordrhein-Westfalen vorige Woche und habe die Kampagne der Lokalzeitungsverleger vor Ort gesucht – und gefunden!
An einer Annahmestelle für Pakete in einem Zeitungsladen. Da lagen – so auf Oberschenkelhöhe, also gut sichtbar – die Postkarten aus, mit denen die Verlage für die Lokalzeitung werben. Auf der Karte soll man ankreuzen, wie oft man eine Tageszeitung kauft und wie wichtig einem die Ressorts und der Anzeigenteil sind. Am Ende der „Umfrage“ mit Gewinnspiel kann man noch ausfüllen, was einem „nicht so gut“ an der Lokalzeitung gefällt, aber da ist nur ganz wenig Platz.
Und jetzt die Quizfrage: Was kann man da wohl so gewinnen, wenn man mitmacht bei einer Lokalzeitungs-Kampagne, die auf Lokalzeitungen aufmerksam machen und für eben diese Lokalzeitungen in NRW begeistern will? Na?
Ein Abo für eine Lokalzeitung?
Och, öhm – nö.